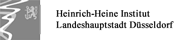| [GAA, Bd. II, S. 601] men Teufels“ aus dem Jahre 1801 fragt Auerhahn einen sehr kleinen Teufel: „Was liesest du denn so aufmerksam, mein Sohn?“ und bekommt zur Antwort: „Den Teufel, wie er sein sollte.“ Darauf belehrt er ihn: „Überspanne deine Phantasie nicht so gewaltig, liebes Kind; in allen diesen Büchern wird nur übertrieben, weil die Verfasser nicht die wirkliche Welt kennen. Hier hast du einen Schilling, dafür kauf' dir ein Buch, wie es sein sollte, nämlich der Teufel, wie er sein kann, und bringe dich wieder in die Richte, sonst wirst du unbrauchbar und ein unnützer Bürger.“ („Nachge- lassene Schriften“, hrsg. von Rudolf Köpke, Bd 1, Leipzig 1855, S. 157—58.)  S.283, Z.41: Lavaters Physiognomik: Die „Physiognomischen Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschen- liebe“ Johann Kaspar Lavaters (1741—1801) sind in den Jahren 1775—78 in Leipzig und Winterthur erschienen; es sind vier starke Quartbände. S.283, Z.41: Lavaters Physiognomik: Die „Physiognomischen Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschen- liebe“ Johann Kaspar Lavaters (1741—1801) sind in den Jahren 1775—78 in Leipzig und Winterthur erschienen; es sind vier starke Quartbände.  S.284, Z.1: Werken der Frau Schoppe: Die als gutherzige Gön- nerin des jungen Hebbel bekannte Amalie Schoppe, geb. Weise (1791—1858), eine ungemein fruchtbare Verfasserin von Werken verschiedener Art, wie Romanen, Erzählungen und Novellen, Ju- gendschriften zur Belehrung und Unterhaltung, Sagen, Märchen und Gedichten. Zahlreiche Beiträge aus ihrer Feder sind im Taschen- buche „Cornelia“ und in Zeitschriften zu finden, wie der „Abend- zeitung“, dem „Gesellschafter“, der „Wiener Zeitschrift für Kunst, Litteratur, Theater und Mode“, Kinds „Muse“, Zschokkes „Erhei- terungen“, Symanskis „Zuschauer“ und Philippis „Merkur“; des- gleichen in den „Neuen Pariser Modeblättern“, die sie vom Juli 1827 an redigierte. S.284, Z.1: Werken der Frau Schoppe: Die als gutherzige Gön- nerin des jungen Hebbel bekannte Amalie Schoppe, geb. Weise (1791—1858), eine ungemein fruchtbare Verfasserin von Werken verschiedener Art, wie Romanen, Erzählungen und Novellen, Ju- gendschriften zur Belehrung und Unterhaltung, Sagen, Märchen und Gedichten. Zahlreiche Beiträge aus ihrer Feder sind im Taschen- buche „Cornelia“ und in Zeitschriften zu finden, wie der „Abend- zeitung“, dem „Gesellschafter“, der „Wiener Zeitschrift für Kunst, Litteratur, Theater und Mode“, Kinds „Muse“, Zschokkes „Erhei- terungen“, Symanskis „Zuschauer“ und Philippis „Merkur“; des- gleichen in den „Neuen Pariser Modeblättern“, die sie vom Juli 1827 an redigierte.  S.284, Z.9: den Herrn Raupach: Ernst Raupach (1784—1852) war 1822 von Rußland, wo er als Erzieher, Prediger und Dozent gelebt hatte, nach Deutschland zurückgekehrt und hatte sich 1824 in Berlin niedergelassen. Am dortigen Hof- und auch am Wiener Burgtheater waren bereits mehrere seiner Stücke, welche russische Stoffe behandelten, aufgeführt worden und hatten seinen Ruf als Dramatiker begründet. Nunmehr setzte eine Massenerzeugung ein, die kein Zugeständnis an den Geschmack des Tages verschmähte, um bühnenwirksam zu sein, und sichtlich auf Erwerb abzielte. In der Tat hat es Raupach erreicht, daß er etwa fünfzehn Jahre hin- durch eine weitreichende Herrschaft über den Spielplan der Berliner Bühne ausgeübt hat, mit Trauerspielen, von denen „Isidor und Olga“, die russische Leibeigenschaft anklagend (März 1825 in Berlin aufgeführt), eines der berühmtesten ist, und mit Lustspielen, für die er die feststehenden Gestalten des Till und des Schelle schuf, wie „Die Schleichhändler“, gegen die Scottomanie gerichtet (März 1828 in Berlin aufgeführt). S.284, Z.9: den Herrn Raupach: Ernst Raupach (1784—1852) war 1822 von Rußland, wo er als Erzieher, Prediger und Dozent gelebt hatte, nach Deutschland zurückgekehrt und hatte sich 1824 in Berlin niedergelassen. Am dortigen Hof- und auch am Wiener Burgtheater waren bereits mehrere seiner Stücke, welche russische Stoffe behandelten, aufgeführt worden und hatten seinen Ruf als Dramatiker begründet. Nunmehr setzte eine Massenerzeugung ein, die kein Zugeständnis an den Geschmack des Tages verschmähte, um bühnenwirksam zu sein, und sichtlich auf Erwerb abzielte. In der Tat hat es Raupach erreicht, daß er etwa fünfzehn Jahre hin- durch eine weitreichende Herrschaft über den Spielplan der Berliner Bühne ausgeübt hat, mit Trauerspielen, von denen „Isidor und Olga“, die russische Leibeigenschaft anklagend (März 1825 in Berlin aufgeführt), eines der berühmtesten ist, und mit Lustspielen, für die er die feststehenden Gestalten des Till und des Schelle schuf, wie „Die Schleichhändler“, gegen die Scottomanie gerichtet (März 1828 in Berlin aufgeführt).  S.284, Z.27: Immermann: Karl Lebrecht Immermann (1796 bis 1840) lebte seit dem Anfang des Jahres 1827 in Düsseldorf, wohin er als Landesgerichtsrat versetzt worden war. Seine dra- matische Produktion der Zwanzigerjahre, ritterliche Trauerspiele, S.284, Z.27: Immermann: Karl Lebrecht Immermann (1796 bis 1840) lebte seit dem Anfang des Jahres 1827 in Düsseldorf, wohin er als Landesgerichtsrat versetzt worden war. Seine dra- matische Produktion der Zwanzigerjahre, ritterliche Trauerspiele, |
| |