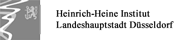| [GAA, Bd. IV, S. 473] 1aBriefwechsel zwischen Schiller und Goethe  S.102, Z.26 f.: wie z. E. Rom die Wolfstochter [usw.]: Die Stelle findet sich im Nachtrag zur zweiten, den Römern gewidmeten Abteilung des historischen Teiles der „Farbenlehre“ und lautet: „Die Römer waren aus einem engen, sittlichen, bequemen, behaglichen, bürgerlichen Zustand zur großen Breite der Weltherrschaft gelangt, ohne ihre Beschränktheit abzulegen; selbst das, was man an ihnen als Freyheitssinn schätzt, ist nur ein bornirtes Wesen.“ („Zur Farbenlehre“, Bd 2, Tübingen, Cotta 1810, S. 126.) S.102, Z.26 f.: wie z. E. Rom die Wolfstochter [usw.]: Die Stelle findet sich im Nachtrag zur zweiten, den Römern gewidmeten Abteilung des historischen Teiles der „Farbenlehre“ und lautet: „Die Römer waren aus einem engen, sittlichen, bequemen, behaglichen, bürgerlichen Zustand zur großen Breite der Weltherrschaft gelangt, ohne ihre Beschränktheit abzulegen; selbst das, was man an ihnen als Freyheitssinn schätzt, ist nur ein bornirtes Wesen.“ („Zur Farbenlehre“, Bd 2, Tübingen, Cotta 1810, S. 126.)  S.102, Z.40 ff.: Ach, wie devot [usw.]: Der Briefwechsel wurde durch den aus Jena vom 13. Juni 1794 datierten Brief Schillers eingeleitet, in dem Goethe zur Mitarbeit an den „Horen“ aufgefordert wird. Darin heißt es u. a.: „Hier in Jena haben sich die HH. Fichte, Woltmann und von Humboldt zur Herausgabe dieser Zeitschrift vereinigt, und da, einer nothwendigen Einrichtung gemäß, über alle einlaufenden Manuscripte die Urtheile eines engern Ausschusses eingeholt werden sollen, so würden Ew. Hochwohlgeboren uns unendlich verpflichten, wenn Sie erlauben wollten, daß Ihnen zu Zeiten eins der eingesandten Manuscripte dürfte zur Beurtheilung vorgelegt werden.“ (Th. 1, S. 1—2.) — Woltmann: Karl Ludwig von W. (1770—1817), Geschichtschreiber, Übersetzer und Romanschriftsteller, war 1795 von Göttingen als außerordentlicher Professor der Philosophie nach Jena berufen worden. — von Humboldt: Wilhelm. — Auf den zitierten Passus bezieht sich die folgende Stelle in Goethes Antwort, datiert aus Weimar vom 24. Juni 1794: „...; gewiß aber wird eine nähere Verbindung mit so wackern Männern als die Unternehmer sind, manches, was bei mir in's Stocken gerathen ist, wieder in einen lebhaften Gang bringen.“ (a.a.O., S. 10.) S.102, Z.40 ff.: Ach, wie devot [usw.]: Der Briefwechsel wurde durch den aus Jena vom 13. Juni 1794 datierten Brief Schillers eingeleitet, in dem Goethe zur Mitarbeit an den „Horen“ aufgefordert wird. Darin heißt es u. a.: „Hier in Jena haben sich die HH. Fichte, Woltmann und von Humboldt zur Herausgabe dieser Zeitschrift vereinigt, und da, einer nothwendigen Einrichtung gemäß, über alle einlaufenden Manuscripte die Urtheile eines engern Ausschusses eingeholt werden sollen, so würden Ew. Hochwohlgeboren uns unendlich verpflichten, wenn Sie erlauben wollten, daß Ihnen zu Zeiten eins der eingesandten Manuscripte dürfte zur Beurtheilung vorgelegt werden.“ (Th. 1, S. 1—2.) — Woltmann: Karl Ludwig von W. (1770—1817), Geschichtschreiber, Übersetzer und Romanschriftsteller, war 1795 von Göttingen als außerordentlicher Professor der Philosophie nach Jena berufen worden. — von Humboldt: Wilhelm. — Auf den zitierten Passus bezieht sich die folgende Stelle in Goethes Antwort, datiert aus Weimar vom 24. Juni 1794: „...; gewiß aber wird eine nähere Verbindung mit so wackern Männern als die Unternehmer sind, manches, was bei mir in's Stocken gerathen ist, wieder in einen lebhaften Gang bringen.“ (a.a.O., S. 10.)  S.103, Z.22 ff.: Ferner wimmelt der Briefwechsel von den elendesten Lappalien [usw.]: Auch Michael Beer fand bei der Lektüre des sechsten Teils des „Briefwechsels“, zuletzt würden die Briefe denn doch etwas „zettelhaft“. „Ein continuirliches Publiciren von Einladungen zum Essen und Spazierenfahren“ bringe denn doch auf den „Verdacht einer Buchhändlerspeculation“. (Brief an Immermann, datiert aus Paris vom 29. Januar 1830, Beers „Briefwechsel“ S. 150.) S.103, Z.22 ff.: Ferner wimmelt der Briefwechsel von den elendesten Lappalien [usw.]: Auch Michael Beer fand bei der Lektüre des sechsten Teils des „Briefwechsels“, zuletzt würden die Briefe denn doch etwas „zettelhaft“. „Ein continuirliches Publiciren von Einladungen zum Essen und Spazierenfahren“ bringe denn doch auf den „Verdacht einer Buchhändlerspeculation“. (Brief an Immermann, datiert aus Paris vom 29. Januar 1830, Beers „Briefwechsel“ S. 150.)  S.104, Z.2—7: Man hat in Weimar [usw.]: Als im Jahre 1826 das alte Kassengewölbe des Weimarer Friedhofs, in dem Schiller bestattet worden war, geräumt werden sollte, wurden die Gebeine des Dichters mit Mühe zusammengesucht und sein Schädel, oder das, was man dafür hielt, auf Befehl des Großherzogs Karl August am 17. September 1826 im Postamente der Dannecker'schen Marmorbüste Schillers auf der Weimarer Bibliothek verwahrt, die übrigen Gebeine aber interimistisch eingesargt. Goethe hat diesem feierlichen Akte nicht beigewohnt, während der folgenden Tage aber bei Betrachtung des Schädels, der sich zu jener Zeit in seiner Wohnung befand, die Terzinen „Im ernsten Beinhaus war's“ gedichtet. König Ludwig I. von Bayern hat es durchgesetzt, daß Schädel und Gebeine wieder vereinigt und am 16. September 1827 in der Fürstengruft beigesetzt wurden. S.104, Z.2—7: Man hat in Weimar [usw.]: Als im Jahre 1826 das alte Kassengewölbe des Weimarer Friedhofs, in dem Schiller bestattet worden war, geräumt werden sollte, wurden die Gebeine des Dichters mit Mühe zusammengesucht und sein Schädel, oder das, was man dafür hielt, auf Befehl des Großherzogs Karl August am 17. September 1826 im Postamente der Dannecker'schen Marmorbüste Schillers auf der Weimarer Bibliothek verwahrt, die übrigen Gebeine aber interimistisch eingesargt. Goethe hat diesem feierlichen Akte nicht beigewohnt, während der folgenden Tage aber bei Betrachtung des Schädels, der sich zu jener Zeit in seiner Wohnung befand, die Terzinen „Im ernsten Beinhaus war's“ gedichtet. König Ludwig I. von Bayern hat es durchgesetzt, daß Schädel und Gebeine wieder vereinigt und am 16. September 1827 in der Fürstengruft beigesetzt wurden.  S.104, Z.15: Garve: Christian G. (1742—1798) 1766—1772 S.104, Z.15: Garve: Christian G. (1742—1798) 1766—1772 |
| |