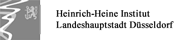| [GAA, Bd. IV, S. 400] Heraldik“, Hamlet in II,2.  S.33, Z.17—20: Goethe, nachdem er mit dem Werther [usw.]: Das Schauspiel „Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand“ ist im Juni 1773 erschienen, die erste Fassung der „Leiden des jungen Werthers“ im Jahre danach. S.33, Z.17—20: Goethe, nachdem er mit dem Werther [usw.]: Das Schauspiel „Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand“ ist im Juni 1773 erschienen, die erste Fassung der „Leiden des jungen Werthers“ im Jahre danach.  S.33, Z.37: die Übersetzungen des Tancred, des Mahomet: von Voltaire. S.33, Z.37: die Übersetzungen des Tancred, des Mahomet: von Voltaire.  S.34, Z.25 f.: Er selbst spricht in dem Vorworte der Braut von Messina: „Ueber den Gebrauch des Chors in der Tragödie“; vgl. die Stelle: „Der alte Chor in das französische Trauerspiel eingeführt, würde es in seiner ganzen Dürftigkeit darstellen und zunichte machen; eben derselbe würde ohne Zweifel Shakespears Tragödie erst ihre wahre Bedeutung geben.“ (Erstdruck vom Jahre 1803, S. XII.) S.34, Z.25 f.: Er selbst spricht in dem Vorworte der Braut von Messina: „Ueber den Gebrauch des Chors in der Tragödie“; vgl. die Stelle: „Der alte Chor in das französische Trauerspiel eingeführt, würde es in seiner ganzen Dürftigkeit darstellen und zunichte machen; eben derselbe würde ohne Zweifel Shakespears Tragödie erst ihre wahre Bedeutung geben.“ (Erstdruck vom Jahre 1803, S. XII.)  S.34, Z.37 f.: wie schon Pustkuchen in seinen Wanderjahren nicht mit Unrecht bemerkt: „Wilhelm Meisters Wanderjahre“, die sog. „falschen Wanderjahre“, von Johann Friedrich Wilhelm P. (1793—1834; Schriftsteller-Name: Pustkuchen-Glanzow), gebürtig aus Detmold und zu jener Zeit Pastor in Lieme bei Lemgo, erschienen ohne Nennung des Verfassers in fünf Teilen von 1821—28 bei Gottfried Basse in Quedlinburg und Leipzig, die drei ersten Teile 1823 in neuer verbesserter Auflage. Im dreizehnten Kapitel des ersten Teils geht das literarische Streitgespräch zwischen Wilhelm Meister und dem Hauptmann von Coucy auf die Romantik über. Der Hauptmann erwähnt die Gebrüder Schlegel, Novalis und Tieck, und meint, zu den höchsten Weihen der Kunst schienen sie alle vier nicht von der Natur berufen gewesen; denn selbst Novalis habe sich nicht höher als zu der Idee erhoben, „die Wissenschaft mit der Poesie auf eine genügende Art zu vereinen“. Überrascht fragt Wilhelm, ob denn des Anderen mißbilligendes Urteil nicht allein Goethen, sondern der ganzen romantischen Poesie gelte; worauf man sich zunächst über das „undeutliche Lieblingswort “ zu verständigen sucht. Darauf begründet Coucy seine Ansicht. Er sieht die Eigentümlichkeit der poetischen Schule, der die Auseinandersetzung gilt, in einer Verwechslung der jugendlichen Lebensbetrachtung mit der dichterischen; er weist darauf hin, daß „Planlosigkeit und Bedeutungsleerheit“ von den neueren Romantikern ganz unverhohlen in Schutz genommen und mit Ariosts Beispiel verteidigt werde, und findet, an Idee oder eigentlicher Bedeutung gebreche es ihren Dichtungen so durchaus und völlig, als den Werken Goethes, den er, zum Unterschiede von den wahrhaft großen, weil im Symbole sich offenbarenden Dichtern, einen Tendenziarier nennt. Dabei rechnet er die bekannteren unter den neusten Dichtern nicht zur romantischen Partei, weder Fouqué und Hoffmann, noch Müllner, Grillparzer und Houwald. Denn diese stünden selbständig auf einem eigentümlichen Boden und seien von den einseitigen Ansichten der Schule bereits wieder eben so frei, als die dieser voraufgegangenen Dichter. Ihr Auftreten begrenze die Periode der pseudo-romantischen Schule, als einer bloßen Zeiterscheinung, die eben so bald vorübergegangen sei, als die früheren der Empfindelei und der derben Natürlichkeit. Darum hätten sie S.34, Z.37 f.: wie schon Pustkuchen in seinen Wanderjahren nicht mit Unrecht bemerkt: „Wilhelm Meisters Wanderjahre“, die sog. „falschen Wanderjahre“, von Johann Friedrich Wilhelm P. (1793—1834; Schriftsteller-Name: Pustkuchen-Glanzow), gebürtig aus Detmold und zu jener Zeit Pastor in Lieme bei Lemgo, erschienen ohne Nennung des Verfassers in fünf Teilen von 1821—28 bei Gottfried Basse in Quedlinburg und Leipzig, die drei ersten Teile 1823 in neuer verbesserter Auflage. Im dreizehnten Kapitel des ersten Teils geht das literarische Streitgespräch zwischen Wilhelm Meister und dem Hauptmann von Coucy auf die Romantik über. Der Hauptmann erwähnt die Gebrüder Schlegel, Novalis und Tieck, und meint, zu den höchsten Weihen der Kunst schienen sie alle vier nicht von der Natur berufen gewesen; denn selbst Novalis habe sich nicht höher als zu der Idee erhoben, „die Wissenschaft mit der Poesie auf eine genügende Art zu vereinen“. Überrascht fragt Wilhelm, ob denn des Anderen mißbilligendes Urteil nicht allein Goethen, sondern der ganzen romantischen Poesie gelte; worauf man sich zunächst über das „undeutliche Lieblingswort “ zu verständigen sucht. Darauf begründet Coucy seine Ansicht. Er sieht die Eigentümlichkeit der poetischen Schule, der die Auseinandersetzung gilt, in einer Verwechslung der jugendlichen Lebensbetrachtung mit der dichterischen; er weist darauf hin, daß „Planlosigkeit und Bedeutungsleerheit“ von den neueren Romantikern ganz unverhohlen in Schutz genommen und mit Ariosts Beispiel verteidigt werde, und findet, an Idee oder eigentlicher Bedeutung gebreche es ihren Dichtungen so durchaus und völlig, als den Werken Goethes, den er, zum Unterschiede von den wahrhaft großen, weil im Symbole sich offenbarenden Dichtern, einen Tendenziarier nennt. Dabei rechnet er die bekannteren unter den neusten Dichtern nicht zur romantischen Partei, weder Fouqué und Hoffmann, noch Müllner, Grillparzer und Houwald. Denn diese stünden selbständig auf einem eigentümlichen Boden und seien von den einseitigen Ansichten der Schule bereits wieder eben so frei, als die dieser voraufgegangenen Dichter. Ihr Auftreten begrenze die Periode der pseudo-romantischen Schule, als einer bloßen Zeiterscheinung, die eben so bald vorübergegangen sei, als die früheren der Empfindelei und der derben Natürlichkeit. Darum hätten sie |
| |