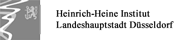| [GAA, Bd. III, S. 670]  S.351, Z.16: Eggius: Siehe die S.351, Z.16: Eggius: Siehe die  Anm. zu S. 157, Z. 14. Anm. zu S. 157, Z. 14.  S.352, Z.8: Fünffingrige Manipelzeichen: Siehe die S.352, Z.8: Fünffingrige Manipelzeichen: Siehe die  Anm. zu S. 224, Z. 26. Anm. zu S. 224, Z. 26.  S.354, Z.1: Grüttemeier: Siehe die S.354, Z.1: Grüttemeier: Siehe die  Anm. zu S. 178, Z. 26. Anm. zu S. 178, Z. 26.  S.355, Z.16 f.: en echiquier: In Form eines Schachbrettes. S.355, Z.16 f.: en echiquier: In Form eines Schachbrettes.  S.355, Z.39: Dörenschlucht: Siehe die S.355, Z.39: Dörenschlucht: Siehe die  Anm. zu S. 217, Z. 6. Anm. zu S. 217, Z. 6.  S.357, Z.31: Bardiete: Bardiet ist ein im achtzehnten Jahr- hundert zur Blütezeit der Bardendichtung nach dem lat. 'barditus' (in des Tacitus „Germania“ 3, 2) gebildetes Wort. 'barditus' bedeutet Schlachtgeschrei, Kriegsgesang, Schlachtgesang der Barbaren und hat mit den Barden nichts zu schaffen. S.357, Z.31: Bardiete: Bardiet ist ein im achtzehnten Jahr- hundert zur Blütezeit der Bardendichtung nach dem lat. 'barditus' (in des Tacitus „Germania“ 3, 2) gebildetes Wort. 'barditus' bedeutet Schlachtgeschrei, Kriegsgesang, Schlachtgesang der Barbaren und hat mit den Barden nichts zu schaffen.  S.358, Z.1: porta decumana: Siehe die S.358, Z.1: porta decumana: Siehe die  Anm. zu S. 180, Z. 2—3. Anm. zu S. 180, Z. 2—3.  S.358, Z.4: Senner: Siehe die S.358, Z.4: Senner: Siehe die  Anm. zu S. 171, Z. 28. Anm. zu S. 171, Z. 28.  S.358, Z.30: Brink: Ein mit Gras bewachsenes, hügeliges Stück Land; das niederdeutsche Wort entspricht der Bedeutung des hoch- deutschen 'Anger'. S.358, Z.30: Brink: Ein mit Gras bewachsenes, hügeliges Stück Land; das niederdeutsche Wort entspricht der Bedeutung des hoch- deutschen 'Anger'.  S.360, Z.1: Rüster von Eiche: Da Rüster ein Name von Bäumen, meist gleichbedeutend mit 'Ulme' ist, so wird diese Zu- sammenstellung von Sanders („Wörterbuch“ Bd 2, 1. Hälfte, Leip- zig 1863, S. 822) mit der irrigen Quellenangabe „Hann. 85“ als ungewöhnlich bezeichnet und die Bedeutung 'Stamm', 'Stumpf' ver- mutet. S.360, Z.1: Rüster von Eiche: Da Rüster ein Name von Bäumen, meist gleichbedeutend mit 'Ulme' ist, so wird diese Zu- sammenstellung von Sanders („Wörterbuch“ Bd 2, 1. Hälfte, Leip- zig 1863, S. 822) mit der irrigen Quellenangabe „Hann. 85“ als ungewöhnlich bezeichnet und die Bedeutung 'Stamm', 'Stumpf' ver- mutet.  S.361, Z.5: Präfektus Prätorio: Befehlshaber der kaiserlichen Leibgarde. S.361, Z.5: Präfektus Prätorio: Befehlshaber der kaiserlichen Leibgarde.  S.361, Z.14: Palatium: Siehe die S.361, Z.14: Palatium: Siehe die  Anm. zu S. 173, Z. 32. Anm. zu S. 173, Z. 32.  S.362, Z.1: Ravensberger: Siehe die S.362, Z.1: Ravensberger: Siehe die  Anm. zu S. 180, Z. 38. Anm. zu S. 180, Z. 38.  S.362, Z.14: Principes: Ursprünglich das erste Glied der Schlachtreihe, dann die Schwerbewaffneten zwischen hastati (dem ersten Gliede im römischen Treffen) und triarii (den ältesten und erfahrensten Kriegern, die das dritte Treffen bildeten). S.362, Z.14: Principes: Ursprünglich das erste Glied der Schlachtreihe, dann die Schwerbewaffneten zwischen hastati (dem ersten Gliede im römischen Treffen) und triarii (den ältesten und erfahrensten Kriegern, die das dritte Treffen bildeten).  S.362, Z.14: Triarier: Siehe die Anm. zu Bd 1, S. 311, Z. 17 auf S.362, Z.14: Triarier: Siehe die Anm. zu Bd 1, S. 311, Z. 17 auf  S. 643. S. 643.  S.362, Z.36: Retlage: Siehe die S.362, Z.36: Retlage: Siehe die  Anm. zu S. 181, Z. 24. Anm. zu S. 181, Z. 24.  S.364, Z.2: Vidimation: Beglaubigung und Bestätigung einer Schrift. S.364, Z.2: Vidimation: Beglaubigung und Bestätigung einer Schrift.  S.364, Z.13: in dolo: zu sein: Eine Täuschung zu beabsichtigen, betrügerische Absichten zu haben. S.364, Z.13: in dolo: zu sein: Eine Täuschung zu beabsichtigen, betrügerische Absichten zu haben.  S.367, Z.6: Engerer: Siehe die S.367, Z.6: Engerer: Siehe die  Anm. zu S. 181, Z. 1. Anm. zu S. 181, Z. 1.  S.368, Z.10: schlackerwettert: Siehe die S.368, Z.10: schlackerwettert: Siehe die  Anm. zu S. 293, Z. 10. Anm. zu S. 293, Z. 10.  S.369, Z.16: Knochen- und Blutbach: Siehe die S.369, Z.16: Knochen- und Blutbach: Siehe die  Anm. zu S. 157, Z. 12. Anm. zu S. 157, Z. 12.  S.369, Z.36: Senne: Siehe die S.369, Z.36: Senne: Siehe die  Anm. zu S. 168, Z. 23. Anm. zu S. 168, Z. 23.  S.371, Z.3: Windfeld: Siehe die S.371, Z.3: Windfeld: Siehe die  Anm. zu S. 246, Z. 4. Anm. zu S. 246, Z. 4.  S.371, Z.33: Acheron: In der Mythologie der Alten ein Fluß der Unterwelt; später der Hauptfluß, der sie umgrenzt. S.371, Z.33: Acheron: In der Mythologie der Alten ein Fluß der Unterwelt; später der Hauptfluß, der sie umgrenzt.  S.373, Z.31: Orbilius: L. O. Pupillus, ein Grammatiker aus Benevent (114 — um 14 v. Chr.), wurde in vorgerücktem Alter Lehrer, zuerst in seiner Vaterstadt, nachher in Rom. Er stand in hohem Ansehen, unterrichtete die Söhne der vornehmsten Familien, machte aber dabei gern von der Rute Gebrauch und wurde des- S.373, Z.31: Orbilius: L. O. Pupillus, ein Grammatiker aus Benevent (114 — um 14 v. Chr.), wurde in vorgerücktem Alter Lehrer, zuerst in seiner Vaterstadt, nachher in Rom. Er stand in hohem Ansehen, unterrichtete die Söhne der vornehmsten Familien, machte aber dabei gern von der Rute Gebrauch und wurde des- |
| |