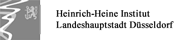| [GAA, Bd. III, S. 598] gesprochen werden kann. Denn als die Grafen von Calvelage am Osning Fuß faßten, stützten sie sich auf eine Burg am Südab- hange des Gebirgswalles westlich von Halle i. W., die „ruwe Borg“, und nach dieser nannte sich Otto I. (1141—1170), der dritte in der Reihe der Calvelager Dynasten, Graf von Ravens- berg. „Die Grafschaft umfaßte die Gebiete von Versmold, Halle, Borgholzhausen im Teutoburger Walde, ferner das Land um Biele- feld mit der Sparrenburg und den Hauptorten Brackwede, Heepen, Schildesche, Werther, im N.[orden] die 1319 erwähnte alte Lim- burg mit Bünde und Oldendorp und nach der Weser hin Vlotho, Rehme und Exter.“ (Konrad Kretschmer, „Historische Geographie von Mitteleuropa“, München u. Berlin 1904 = „Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte“ IV, [6], S. 252—53.)  S.181, Z.1: Engerer: Die Angrivarii des Tacitus („Annalen“ 2, 19); deutsches Volk auf beiden Seiten der Weser, nordöstlich von den Cheruskern und von diesen durch einen Grenzwall ge- schieden. Einen schnell gedämpften Aufstand im Jahre 16 n. Chr. abgerechnet, waren die A. den Römern befreundet. S.181, Z.1: Engerer: Die Angrivarii des Tacitus („Annalen“ 2, 19); deutsches Volk auf beiden Seiten der Weser, nordöstlich von den Cheruskern und von diesen durch einen Grenzwall ge- schieden. Einen schnell gedämpften Aufstand im Jahre 16 n. Chr. abgerechnet, waren die A. den Römern befreundet.  S.181, Z.1: Lemgoer: Lemgo ist eine lippische, wohl schon um 1200 angelegte Stadt an der Straße Osnabrück — Herford — Hameln, einstmals die bedeutendste Handelsstadt des Landes. S.181, Z.1: Lemgoer: Lemgo ist eine lippische, wohl schon um 1200 angelegte Stadt an der Straße Osnabrück — Herford — Hameln, einstmals die bedeutendste Handelsstadt des Landes.  S.181, Z.15: Pluto: Siehe die Anm. zu Bd 1, S. 326, Z. 12 auf S.181, Z.15: Pluto: Siehe die Anm. zu Bd 1, S. 326, Z. 12 auf  S. 647—48. S. 647—48.  S.181, Z.24: Retlage: Dieser Bach entspringt zwischen dem Nordausgang der Dörenschlucht und dem Kahlen Ehberge, fließt nach Nordosten und ergießt sich in die Werre. S.181, Z.24: Retlage: Dieser Bach entspringt zwischen dem Nordausgang der Dörenschlucht und dem Kahlen Ehberge, fließt nach Nordosten und ergießt sich in die Werre.  S.182, Z.7: Lemgau: In einer Urkunde vom 20. Juli 1005 bestätigt König Heinrich II. dem Erzstifte Magdeburg die von seinem Vorgänger Otto III. geschehene Schenkung der civitas Scidere (Schieder) mit allen ihren Zubehörungen in den Gauen Gesinegauwe, Wetego, Thilete, Limgauwe usw. („Lippische Re- gesten“ Nr 13, Bd 1, 1860, S. 58.) Hier ist zum ersten Male die Rede von einem Gaue, der die Gegend des heutigen Lemgo um- faßt. Nach Adolf Gregorius' Forschungen zur Frühzeit Lemgos („Mitteilungen aus der lippischen Geschichte und Landeskunde“ Bd 17, 1939, S. 7) ist 'Limgauwe' der Dativ des Wortes 'Limga', das Grundwort 'gâ' das neuhochdeutsche 'Gau'. S.182, Z.7: Lemgau: In einer Urkunde vom 20. Juli 1005 bestätigt König Heinrich II. dem Erzstifte Magdeburg die von seinem Vorgänger Otto III. geschehene Schenkung der civitas Scidere (Schieder) mit allen ihren Zubehörungen in den Gauen Gesinegauwe, Wetego, Thilete, Limgauwe usw. („Lippische Re- gesten“ Nr 13, Bd 1, 1860, S. 58.) Hier ist zum ersten Male die Rede von einem Gaue, der die Gegend des heutigen Lemgo um- faßt. Nach Adolf Gregorius' Forschungen zur Frühzeit Lemgos („Mitteilungen aus der lippischen Geschichte und Landeskunde“ Bd 17, 1939, S. 7) ist 'Limgauwe' der Dativ des Wortes 'Limga', das Grundwort 'gâ' das neuhochdeutsche 'Gau'.  S.182, Z.26: Hastaten: Mit der Lanze Bewaffnete; das erste Glied im römischen Treffen. S.182, Z.26: Hastaten: Mit der Lanze Bewaffnete; das erste Glied im römischen Treffen.  S.183, Z.23: Marsen: Sie saßen an der oberen Ruhr und Lippe; man hält sie für identisch mit den Chattuarii, die später auf links- rheinischem Gebiete um Cleve auftraten. Nach den Kämpfen mit Germanicus verschwinden die M. aus der Geschichte. S.183, Z.23: Marsen: Sie saßen an der oberen Ruhr und Lippe; man hält sie für identisch mit den Chattuarii, die später auf links- rheinischem Gebiete um Cleve auftraten. Nach den Kämpfen mit Germanicus verschwinden die M. aus der Geschichte.  S.183, Z.32: Segestes: Fürst der Cherusker, Freund der Römer und Feind des Arminius, der ihm seine Tochter Thusnelda ent- führt hatte. 9 n. Chr. warnte er vor der Varusschlacht vergeblich die Römer. Später von Arminius in seiner Burg bedrängt, rief er 15 n. Chr. die Hilfe des Germanicus an, der ihn entsetzte und ihm einen Wohnsitz in Gallien anwies. S.183, Z.32: Segestes: Fürst der Cherusker, Freund der Römer und Feind des Arminius, der ihm seine Tochter Thusnelda ent- führt hatte. 9 n. Chr. warnte er vor der Varusschlacht vergeblich die Römer. Später von Arminius in seiner Burg bedrängt, rief er 15 n. Chr. die Hilfe des Germanicus an, der ihn entsetzte und ihm einen Wohnsitz in Gallien anwies.  S.184, Z.1: Falkenburg: Sie ist wahrscheinlich die älteste Veste, welche die Edelherren zur Lippe errichtet haben, und von Bern- S.184, Z.1: Falkenburg: Sie ist wahrscheinlich die älteste Veste, welche die Edelherren zur Lippe errichtet haben, und von Bern- |
| |