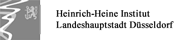| [GAA, Bd. II, S. 794]  S.531, Z.40: besonders von den toten Nonnen: Wohl eine An- spielung auf die Auferstehung der durch Bertram beschworenen Nonnen („Der kalten Gruft sollt Ihr auf kurze Zeit entsteigen. / Erhebet Euch!“) im dritten Aufzuge von Giacomo Meyerbeers Oper „Robert der Teufel“. S.531, Z.40: besonders von den toten Nonnen: Wohl eine An- spielung auf die Auferstehung der durch Bertram beschworenen Nonnen („Der kalten Gruft sollt Ihr auf kurze Zeit entsteigen. / Erhebet Euch!“) im dritten Aufzuge von Giacomo Meyerbeers Oper „Robert der Teufel“.  S.531, Z.41: „Marlborough s'en va-t-en guerre“: Der Anfang eines französischen Volksliedes, das nach der Legende im Biwak zu Quesnoy bei Malplaquet entstanden ist, und zwar am Abend der Schlacht, die während des spanischen Erbfolgekrieges der fran- zösische Marschall de Villars am 11. September 1709 gegen die Österreicher und Engländer unter dem Prinzen Eugen und dem Herzog von Marlborough focht und in der diese beiden Feld- herren siegten. Das heitere Spottlied auf den englischen Herzog, dessen Name in den frühesten Aufzeichnungen des Liedes 'Mal- borough' oder 'Malbrouk' lautet, hatte sich mit seiner schlichten Weise in Deutschland seit etwa 1780 über alle Gegenden verbrei- tet. (Vgl. Max Friedländer, „Das Lied vom Marlborough“, in: „Deutsche Rundschau“, Bd 199, April—Juni 1924, S. 46—65.) S.531, Z.41: „Marlborough s'en va-t-en guerre“: Der Anfang eines französischen Volksliedes, das nach der Legende im Biwak zu Quesnoy bei Malplaquet entstanden ist, und zwar am Abend der Schlacht, die während des spanischen Erbfolgekrieges der fran- zösische Marschall de Villars am 11. September 1709 gegen die Österreicher und Engländer unter dem Prinzen Eugen und dem Herzog von Marlborough focht und in der diese beiden Feld- herren siegten. Das heitere Spottlied auf den englischen Herzog, dessen Name in den frühesten Aufzeichnungen des Liedes 'Mal- borough' oder 'Malbrouk' lautet, hatte sich mit seiner schlichten Weise in Deutschland seit etwa 1780 über alle Gegenden verbrei- tet. (Vgl. Max Friedländer, „Das Lied vom Marlborough“, in: „Deutsche Rundschau“, Bd 199, April—Juni 1924, S. 46—65.)  S.532, Z.3: „Das Glück ist nur Chimäre“: Richtig: „Das Gold ist nur Chimaire“ („E se l'oro è una chimera“), eine Verszeile in der Gesangspartie Bertrams in der Siciliana (7. Szene oder Finale des ersten Aktes) der Oper „Robert der Teufel“ von Meyerbeer, und zwar in der Übersetzung Theodor Hells. (Beim ersten Vorkommen in der Gesangspartie Roberts hat Hell „Gold ist eine Chimaire“ übersetzt.) S.532, Z.3: „Das Glück ist nur Chimäre“: Richtig: „Das Gold ist nur Chimaire“ („E se l'oro è una chimera“), eine Verszeile in der Gesangspartie Bertrams in der Siciliana (7. Szene oder Finale des ersten Aktes) der Oper „Robert der Teufel“ von Meyerbeer, und zwar in der Übersetzung Theodor Hells. (Beim ersten Vorkommen in der Gesangspartie Roberts hat Hell „Gold ist eine Chimaire“ übersetzt.)  S.532, Z.7: Friedrich von Raumer Historiker der Hohenstaufen: Raumers „Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit“ ist 1823 bis 25 bei Brockhaus in Leipzig erschienen. Grabbe hat die sechs Bände in der Zeit vom Herbst 1824 bis Sommer 1825 gelesen; sie sind die wesentlichste Quelle seiner beiden Hohenstaufen-Dramen. S.532, Z.7: Friedrich von Raumer Historiker der Hohenstaufen: Raumers „Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit“ ist 1823 bis 25 bei Brockhaus in Leipzig erschienen. Grabbe hat die sechs Bände in der Zeit vom Herbst 1824 bis Sommer 1825 gelesen; sie sind die wesentlichste Quelle seiner beiden Hohenstaufen-Dramen.  S.532, Z.15: Dr. Schiff: David Bär (nach seiner Taufe, jedoch schon vorher als Schriftsteller: Hermann) Sch. (1801—1867), ein Stiefvetter zweiten Grades von Heinrich Heine. Er hatte „Don Juan und Faust“ im Berliner „Freimüthigen“ (Jg. 26, Nr. 232 und 234—36 vom 20. und 23.—26. November 1829) und „Kaiser Friedrich Barbarossa“ in Gubitzens „Gesellschafter“ (Jg. 14, Nr. 80 vom 17. Mai 1830, S. 393—95) abfällig beurteilt und sich dadurch den Groll Grabbes zugezogen. S.532, Z.15: Dr. Schiff: David Bär (nach seiner Taufe, jedoch schon vorher als Schriftsteller: Hermann) Sch. (1801—1867), ein Stiefvetter zweiten Grades von Heinrich Heine. Er hatte „Don Juan und Faust“ im Berliner „Freimüthigen“ (Jg. 26, Nr. 232 und 234—36 vom 20. und 23.—26. November 1829) und „Kaiser Friedrich Barbarossa“ in Gubitzens „Gesellschafter“ (Jg. 14, Nr. 80 vom 17. Mai 1830, S. 393—95) abfällig beurteilt und sich dadurch den Groll Grabbes zugezogen.  S.532, Z.22: Den Balzac an der Nas einführen: Im Jahre 1830 waren im Verlage der Schlesingerschen Buch- und Musikhand- lung zu Berlin erschienen: „Lebensbilder von Balzac. (Dem Ver- fasser des letzten Chouan, oder die Bretagne im Jahre 1800.)“ Aus dem Französischen übersetzt von Dr. Schiff. Erster Teil. Ein zweiter folgte 1831. Richtig ist aber, daß Schiff den Franzosen nicht übersetzt, sondern frei bearbeitet hat; daß das Wesentliche dieser „Lebensbilder“ von dem Deutschen herrührt. (Vgl. Friedrich Hirths Geschichte des Werks in Bd. 1 seiner Neuausgabe der „Le- bensbilder“, München & Leipzig 1913, S. XXIII.) Im selben Jahre 1831 hatte Schiff, wiederum unter dem Haupttitel „Lebensbilder“, den ersten Teil von „Le Peau de Chagrin“, „Das Elendsfell“ ver- deutscht, in Gubitzens „Gesellschafter“ Nr. 192—201 erscheinen S.532, Z.22: Den Balzac an der Nas einführen: Im Jahre 1830 waren im Verlage der Schlesingerschen Buch- und Musikhand- lung zu Berlin erschienen: „Lebensbilder von Balzac. (Dem Ver- fasser des letzten Chouan, oder die Bretagne im Jahre 1800.)“ Aus dem Französischen übersetzt von Dr. Schiff. Erster Teil. Ein zweiter folgte 1831. Richtig ist aber, daß Schiff den Franzosen nicht übersetzt, sondern frei bearbeitet hat; daß das Wesentliche dieser „Lebensbilder“ von dem Deutschen herrührt. (Vgl. Friedrich Hirths Geschichte des Werks in Bd. 1 seiner Neuausgabe der „Le- bensbilder“, München & Leipzig 1913, S. XXIII.) Im selben Jahre 1831 hatte Schiff, wiederum unter dem Haupttitel „Lebensbilder“, den ersten Teil von „Le Peau de Chagrin“, „Das Elendsfell“ ver- deutscht, in Gubitzens „Gesellschafter“ Nr. 192—201 erscheinen |
| |