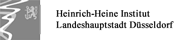| [GAA, Bd. I, S. 616] als solcher weite Reisen unternahm und auch später ein unstetes Leben an verschiedenen italienischen Höfen geführt hat. Das Werk, 1580 begonnen, 1590 veröffentlicht und 1595 zu Crema zum ersten Male aufgeführt, ist ausgezeichnet durch Reichtum der Erfindung, Glanz und Musikalität der Sprache und meisterlichen Versbau. Damit hat es auf die Entwicklung des Schäferdramas des gesamten Kontinents aufs stärkste eingewirkt.  S.265, Z.6: ein emsig dichtender Graf: Vermutlich Ferdinand August Otto Heinrich Graf von Loeben (1786—1825), dessen Werke vielfach unter dem Schriftstellernamen Isidorus oder Isidorus Orientalis erschienen sind. Während seines Studiums in Heidelberg hatte er Arnim, Brentano und Görres kennen gelernt und einen freundschaftlichen Verkehr mit den Brüdern Josef und Wilhelm von Eichendorff unterhalten, später bei Fouqué in Nennhausen ge- lebt und 1814 am Kriege gegen Frankreich teilgenommen. Nach geschlossenem Frieden zog er nach Dresden, trat dort zu den Mit- gliedern des Liederkreises in Beziehung, wurde jedoch im Winter 1822 von einem schlagartigen Anfalle getroffen und erlag seinen Leiden im April 1825. Er war eine schwärmerische, tiefreligiöse Natur, die sich gern ihren weichen, schwermütigen Stimmungen hingab. Sein erstes selbständiges Werk war der 1808 in Mannheim erschienene „Guido“, eine Art philosophischen Märchens in drei Teilen, für das des Novalis unvollendeter „Ofterdingen“ im Gan- zen wie im Einzelnen Vorbild war. Im selben Jahre legte er „Blätter aus dem Reisebüchlein eines andächtigen Pilgers“ vor. 1811/12 folgte der Schäfer- und Ritterroman „Arkadien“. Sind diese Frühwerke Zeugnisse einer ungezügelt waltenden, schrankenlos schwärmenden Einbildungskraft, so zeigen die späteren, z. T. zu Almanachen und Taschenbüchern beigesteuert, das Streben nach größerer Klarheit und Anschaulichkeit. Seine Lyrik, anfangs den Einfluß der späteren Anakreontiker, nachher denjenigen Tiecks und der übrigen Romantiker verratend, zeichnet sich durch eine erstaunliche Vielseitigkeit der Formen aus. S.265, Z.6: ein emsig dichtender Graf: Vermutlich Ferdinand August Otto Heinrich Graf von Loeben (1786—1825), dessen Werke vielfach unter dem Schriftstellernamen Isidorus oder Isidorus Orientalis erschienen sind. Während seines Studiums in Heidelberg hatte er Arnim, Brentano und Görres kennen gelernt und einen freundschaftlichen Verkehr mit den Brüdern Josef und Wilhelm von Eichendorff unterhalten, später bei Fouqué in Nennhausen ge- lebt und 1814 am Kriege gegen Frankreich teilgenommen. Nach geschlossenem Frieden zog er nach Dresden, trat dort zu den Mit- gliedern des Liederkreises in Beziehung, wurde jedoch im Winter 1822 von einem schlagartigen Anfalle getroffen und erlag seinen Leiden im April 1825. Er war eine schwärmerische, tiefreligiöse Natur, die sich gern ihren weichen, schwermütigen Stimmungen hingab. Sein erstes selbständiges Werk war der 1808 in Mannheim erschienene „Guido“, eine Art philosophischen Märchens in drei Teilen, für das des Novalis unvollendeter „Ofterdingen“ im Gan- zen wie im Einzelnen Vorbild war. Im selben Jahre legte er „Blätter aus dem Reisebüchlein eines andächtigen Pilgers“ vor. 1811/12 folgte der Schäfer- und Ritterroman „Arkadien“. Sind diese Frühwerke Zeugnisse einer ungezügelt waltenden, schrankenlos schwärmenden Einbildungskraft, so zeigen die späteren, z. T. zu Almanachen und Taschenbüchern beigesteuert, das Streben nach größerer Klarheit und Anschaulichkeit. Seine Lyrik, anfangs den Einfluß der späteren Anakreontiker, nachher denjenigen Tiecks und der übrigen Romantiker verratend, zeichnet sich durch eine erstaunliche Vielseitigkeit der Formen aus.  S.265, Z.23—29: die eine Erdenhälfte scheint jetzt tot [ usw. ]: Paraphrase aus dem Monologe des Macbeth (II, 3) in der Schil- ler'schen Übersetzung von Shakespeare's Tragödie. — Hekate ist nach den erst im fünften vorchristlichen Jahrhundert zahlreicher einsetzenden Zeugnissen die Göttin der Gespenster und der Geister. Sie wird weder in der „Ilias“ und „Odyssee“, noch in den Fragmenten der Homerischen Epen erwähnt, gehörte vielmehr dem Volksglauben an und gewann mit dessen Vordringen an Be- deutung. Sie wurde nun die Führerin des Geisterheeres und spielte im Aberglauben und Zauber eine große Rolle. Wohl später erst hat sie auch den Charakter als Göttin des nächtlichen Gestirns erhalten. S.265, Z.23—29: die eine Erdenhälfte scheint jetzt tot [ usw. ]: Paraphrase aus dem Monologe des Macbeth (II, 3) in der Schil- ler'schen Übersetzung von Shakespeare's Tragödie. — Hekate ist nach den erst im fünften vorchristlichen Jahrhundert zahlreicher einsetzenden Zeugnissen die Göttin der Gespenster und der Geister. Sie wird weder in der „Ilias“ und „Odyssee“, noch in den Fragmenten der Homerischen Epen erwähnt, gehörte vielmehr dem Volksglauben an und gewann mit dessen Vordringen an Be- deutung. Sie wurde nun die Führerin des Geisterheeres und spielte im Aberglauben und Zauber eine große Rolle. Wohl später erst hat sie auch den Charakter als Göttin des nächtlichen Gestirns erhalten.  S.267, Z.17: par force: mit Gewalt, gewaltsam. S.267, Z.17: par force: mit Gewalt, gewaltsam.  S.267, Z.18 f.: Habt ihr eure Mähnen über eure Galgenphy- siognomien gekämmt: Zur Erläuterung kann eine Stelle in Ales- sandro Manzonis Roman „Die Verlobten“ dienen, wo mitgeteilt wird, daß zu der Zeit, da die Ereignisse sich abspielen, also in der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts, „die Bravi vom S.267, Z.18 f.: Habt ihr eure Mähnen über eure Galgenphy- siognomien gekämmt: Zur Erläuterung kann eine Stelle in Ales- sandro Manzonis Roman „Die Verlobten“ dienen, wo mitgeteilt wird, daß zu der Zeit, da die Ereignisse sich abspielen, also in der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts, „die Bravi vom |
| |