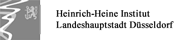| [GAA, Bd. I, S. 611] „Die Seelenmesse“ (II, 109—26) Minas „süßester Wunsch, in Thrä- nen hinzusterben“. Sinnliche Leidenschaften scheinen die Menschen dieser Erzählungen nicht zu kennen. Kaum je ist die Rede davon, daß sie dadurch in Versuchung geführt würden oder ihnen gar unterlägen.  S.257, Z.37: Fanny Tarnow: Franziska Christiane Johanna Friederike, gewöhnlich Fanny T. (1779—1862) war, durch die Not gezwungen, Erzieherin, im Laufe der Zeit aber auch eine be- kannte Schriftstellerin geworden. Seit 1820 lebte sie in Dresden als Mitglied des romantischen Liederkreises, der sich um Theodor Hell, Friedrich Kind und Arthur von Nordstern (Konferenzminister Gott- lob Adolf Ernst v. Nostitz und Jänkendorf) gebildet hatte. Ihre Erstlingserzählung „Alwine von Rosen“ wurde gedruckt in Roch- litzens „Journal für deutsche Frauen“ vom Jahre 1804. Es folgten zunächst: „Natalie, ein Beitrag zur Geschichte des weiblichen Her- zens“ (1811), „unter strömenden Tränen und in höchster Leiden- schaftlichkeit“ geschrieben, „Thorilde von Adlerstein, oder Frauen- herz und Frauenglück; eine Erzählung aus der großen Welt“ (1816), „Mädchenherz und Mädchenglück“ (1817). 1821 begann, unter dem Titel „Lilien“, eine vierbändige Sammlung von Erzählungen und anderen Beiträgen zu erscheinen. Die Romane der Fanny Tarnow gehören zu der neuen, damals aufkommenden Gattung der Ent- sagungsromane, in denen sich die „Sentimentalität mit einer from- men Schwärmerei für die Tugend, mit einer Liebe zu Opfern für die Tugend“ verband, und die insbesondere von Damen geschrie- ben wurden. Ein edelmütiges Mädchen liebt, „aber sie opfert die Befriedigung ihrer Neigung einer höheren Pflicht der Ehre auf und entsagt freiwillig“, stirbt dann wohl auch an gebrochenem Herzen. „Oder sie liebt, wird verrathen, und rächt sich durch die edelste Großmuth“. Dies sei, so schreibt Wolfgang Menzel in seiner „deut- schen Literatur“ (2., verm. Aufl. Th. 4, Stuttgart 1836, S. 53 bis 54), der wesentliche Inhalt der zahlreichen Romane dieser Art. Die der Fanny Tarnow ziehe er den übrigen vor, „weil in ihnen die Tugend am anspruchlosesten und die Zärtlichkeit am wenigsten durch Pruderie bemäntelt erscheint. Sie stellt in allen ihren Werken ein natürlich fühlendes, zärtlich gestimmtes Mädchen dar, das durch die Art, wie es sein Unglück edel erträgt, eines bessern Glückes werth zu seyn beweist, und uns ein Mitleid einflößt, als ob es unsre Tochter wäre.“ (Vgl. ferner Adolf Thimme, „Fanny Tarnow. Eine Skizze ihres Lebens nach neu erschlossenen Quellen“, „Jahr- bücher des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Altertums- kunde“, Jg. 91, 1927, S. 257—78, insbes. S. 261, 278.) S.257, Z.37: Fanny Tarnow: Franziska Christiane Johanna Friederike, gewöhnlich Fanny T. (1779—1862) war, durch die Not gezwungen, Erzieherin, im Laufe der Zeit aber auch eine be- kannte Schriftstellerin geworden. Seit 1820 lebte sie in Dresden als Mitglied des romantischen Liederkreises, der sich um Theodor Hell, Friedrich Kind und Arthur von Nordstern (Konferenzminister Gott- lob Adolf Ernst v. Nostitz und Jänkendorf) gebildet hatte. Ihre Erstlingserzählung „Alwine von Rosen“ wurde gedruckt in Roch- litzens „Journal für deutsche Frauen“ vom Jahre 1804. Es folgten zunächst: „Natalie, ein Beitrag zur Geschichte des weiblichen Her- zens“ (1811), „unter strömenden Tränen und in höchster Leiden- schaftlichkeit“ geschrieben, „Thorilde von Adlerstein, oder Frauen- herz und Frauenglück; eine Erzählung aus der großen Welt“ (1816), „Mädchenherz und Mädchenglück“ (1817). 1821 begann, unter dem Titel „Lilien“, eine vierbändige Sammlung von Erzählungen und anderen Beiträgen zu erscheinen. Die Romane der Fanny Tarnow gehören zu der neuen, damals aufkommenden Gattung der Ent- sagungsromane, in denen sich die „Sentimentalität mit einer from- men Schwärmerei für die Tugend, mit einer Liebe zu Opfern für die Tugend“ verband, und die insbesondere von Damen geschrie- ben wurden. Ein edelmütiges Mädchen liebt, „aber sie opfert die Befriedigung ihrer Neigung einer höheren Pflicht der Ehre auf und entsagt freiwillig“, stirbt dann wohl auch an gebrochenem Herzen. „Oder sie liebt, wird verrathen, und rächt sich durch die edelste Großmuth“. Dies sei, so schreibt Wolfgang Menzel in seiner „deut- schen Literatur“ (2., verm. Aufl. Th. 4, Stuttgart 1836, S. 53 bis 54), der wesentliche Inhalt der zahlreichen Romane dieser Art. Die der Fanny Tarnow ziehe er den übrigen vor, „weil in ihnen die Tugend am anspruchlosesten und die Zärtlichkeit am wenigsten durch Pruderie bemäntelt erscheint. Sie stellt in allen ihren Werken ein natürlich fühlendes, zärtlich gestimmtes Mädchen dar, das durch die Art, wie es sein Unglück edel erträgt, eines bessern Glückes werth zu seyn beweist, und uns ein Mitleid einflößt, als ob es unsre Tochter wäre.“ (Vgl. ferner Adolf Thimme, „Fanny Tarnow. Eine Skizze ihres Lebens nach neu erschlossenen Quellen“, „Jahr- bücher des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Altertums- kunde“, Jg. 91, 1927, S. 257—78, insbes. S. 261, 278.)  S.258, Z.21 f.: ein Schock Poeten wegen ihrer elenden Gedichte hinzurichten: Wilhelm Chezy bemerkt in seinen Lebenserinnerungen mit Bezug auf Friedrich Wilhelm Gubitz: „Er machte auch Verse; das Versemachen war die Krankheit der Zeit.“ („Erinnerungen aus meinem Leben“, a.a.O. S. 116.) S.258, Z.21 f.: ein Schock Poeten wegen ihrer elenden Gedichte hinzurichten: Wilhelm Chezy bemerkt in seinen Lebenserinnerungen mit Bezug auf Friedrich Wilhelm Gubitz: „Er machte auch Verse; das Versemachen war die Krankheit der Zeit.“ („Erinnerungen aus meinem Leben“, a.a.O. S. 116.)  S.258, Z.25: Heinrich Döring: (1789—1862), lebte damals als Privatgelehrter in Jena, wo er Theologie studiert hatte. Er ist vor allem durch seine biographischen Arbeiten über die klassischen und über andere Schriftsteller Deutschlands bekannt geworden; es S.258, Z.25: Heinrich Döring: (1789—1862), lebte damals als Privatgelehrter in Jena, wo er Theologie studiert hatte. Er ist vor allem durch seine biographischen Arbeiten über die klassischen und über andere Schriftsteller Deutschlands bekannt geworden; es |
| |