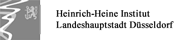| [GAA, Bd. I, S. 606]  S.248, Z.13 f.: in statu quo: zu ergänzen ante: in dem Zustande, wie früher. S.248, Z.13 f.: in statu quo: zu ergänzen ante: in dem Zustande, wie früher.  S.248, Z.15: Kodons: Ein Condom ist eine abschließende Umhül- lung des männlichen Gliedes, die als Schutz vor venerischer Infek- tion, hauptsächlich aber als Schutzmittel zur Verhütung der Empfängnis verwendet wird. Er war bereits im achtzehnten Jahr- hundert im Gebrauch und wurde ursprünglich aus Blinddärmen von Lämmern bereitet, getrocknet und mit Öl und Kleie eingerieben, da- mit er weich und elastisch werde; später auch aus Fischblasen und Goldschlägerhäutchen. Auch der Name 'Condom' kommt zuerst im achtzehnten Jahr- hundert vor, und zwar in Frankreich. Es wird vielfach angenom- men, daß das Wort der Name eines englischen Arztes sei, der den Artikel verbessert habe. Jedoch ist diese Annahme umstritten. Auf jeden Fall ist seine etymologische Erklärung auch heute noch völlig unsicher. Deshalb erscheint es in verschiedenen Formen, wie 'Com- dom', 'Chondon', 'Coton', 'Condon' und 'Condus'. Die Wirksamkeit der K. wurde durch ein päpstliches Breve aus dem Jahre 1826 offen- sichtlich, welches viel dazu beitrug, das Schutzmittel bekannt zu machen. Es verdammte die Erfindung, denn sie hindere die Anord- nungen der Vorsehung, „welche die Geschöpfe an dem Gliede strafen wollte, an dem sie gesündigt“ hätten. (Nach dem Artikel im „Bil- derlexikon der Erotik“, Bd 1, Wien 1928, S. 241 u. 244.) S.248, Z.15: Kodons: Ein Condom ist eine abschließende Umhül- lung des männlichen Gliedes, die als Schutz vor venerischer Infek- tion, hauptsächlich aber als Schutzmittel zur Verhütung der Empfängnis verwendet wird. Er war bereits im achtzehnten Jahr- hundert im Gebrauch und wurde ursprünglich aus Blinddärmen von Lämmern bereitet, getrocknet und mit Öl und Kleie eingerieben, da- mit er weich und elastisch werde; später auch aus Fischblasen und Goldschlägerhäutchen. Auch der Name 'Condom' kommt zuerst im achtzehnten Jahr- hundert vor, und zwar in Frankreich. Es wird vielfach angenom- men, daß das Wort der Name eines englischen Arztes sei, der den Artikel verbessert habe. Jedoch ist diese Annahme umstritten. Auf jeden Fall ist seine etymologische Erklärung auch heute noch völlig unsicher. Deshalb erscheint es in verschiedenen Formen, wie 'Com- dom', 'Chondon', 'Coton', 'Condon' und 'Condus'. Die Wirksamkeit der K. wurde durch ein päpstliches Breve aus dem Jahre 1826 offen- sichtlich, welches viel dazu beitrug, das Schutzmittel bekannt zu machen. Es verdammte die Erfindung, denn sie hindere die Anord- nungen der Vorsehung, „welche die Geschöpfe an dem Gliede strafen wollte, an dem sie gesündigt“ hätten. (Nach dem Artikel im „Bil- derlexikon der Erotik“, Bd 1, Wien 1928, S. 241 u. 244.)  S.250, Z.41 f.: platt wie eine Erzählung von der Karoline Pichler: Karoline P. war am 7. Sept. 1769 in Wien als Tochter des Hofrats Greiner geboren, in dessen Hause das literarische Leben der Residenz lange Zeit einen Mittelpunkt fand. Ihre Jugend fiel in die there- sianische Zeit, und 1843, wenige Jahre vor den Stürmen der Revo- lution, ist sie in ihrer Vaterstadt gestorben. Von allen geistigen Strömungen, welche diesen Zeitraum bestimmen, ist sie berührt wor- den. Als gläubige Katholikin aufwachsend, im Barock wurzelnd, hat sie Einflüsse von der Aufklärung und der Periode der Empfindsam- keit ebenso erfahren, wie von Klassik und Romantik, und selbst der schließlich aufkommende Realismus ist in ihrem Spät-Schaffen zu spüren. Ihre Begabung war jedoch nicht so stark, daß persönliche Eigenart sich immer gegen solch äußere Einflüsse hätte durchsetzen können. Karoline P. hat neben ihren Pflichten als Gattin und Mutter, ihrem Umgange mit zahlreichen geistig bedeutenden Persön- lichkeiten und einem regen Briefwechsel noch Zeit gefunden, Schrift- stellerin zu sein. Sie schrieb viel und leicht, nicht so sehr aus innerem Drange, als in der Absicht, ihren Mitmenschen das Leben zu ver- schönern, ihnen Erhebung und Freude zu bringen. Sie begann mit Gedichten. Bekannt machten sie die „Gleichnisse“ (1800). Ihnen folg- ten 1803 die „Idyllen“, weiterhin Balladen, Dramen und Romane, eine Gattung, die sie deswegen bevorzugte, weil sie es liebte, „lang- sam und wohlberechnet die Fortschritte der Empfindungen, die un- merklichen Übergänge in den menschlichen Gemütern mit beobach- tendem Auge zu verfolgen und darzustellen“ („Denkwürdigkeiten aus meinem Leben“ I, 398). Während der Jahre 1815—23 schrieb sie eine Reihe von Erzählungen, in denen sie sich schon 1804 und 1805 versucht hatte. Sie erschienen vornehmlich zuerst in Almanachen, S.250, Z.41 f.: platt wie eine Erzählung von der Karoline Pichler: Karoline P. war am 7. Sept. 1769 in Wien als Tochter des Hofrats Greiner geboren, in dessen Hause das literarische Leben der Residenz lange Zeit einen Mittelpunkt fand. Ihre Jugend fiel in die there- sianische Zeit, und 1843, wenige Jahre vor den Stürmen der Revo- lution, ist sie in ihrer Vaterstadt gestorben. Von allen geistigen Strömungen, welche diesen Zeitraum bestimmen, ist sie berührt wor- den. Als gläubige Katholikin aufwachsend, im Barock wurzelnd, hat sie Einflüsse von der Aufklärung und der Periode der Empfindsam- keit ebenso erfahren, wie von Klassik und Romantik, und selbst der schließlich aufkommende Realismus ist in ihrem Spät-Schaffen zu spüren. Ihre Begabung war jedoch nicht so stark, daß persönliche Eigenart sich immer gegen solch äußere Einflüsse hätte durchsetzen können. Karoline P. hat neben ihren Pflichten als Gattin und Mutter, ihrem Umgange mit zahlreichen geistig bedeutenden Persön- lichkeiten und einem regen Briefwechsel noch Zeit gefunden, Schrift- stellerin zu sein. Sie schrieb viel und leicht, nicht so sehr aus innerem Drange, als in der Absicht, ihren Mitmenschen das Leben zu ver- schönern, ihnen Erhebung und Freude zu bringen. Sie begann mit Gedichten. Bekannt machten sie die „Gleichnisse“ (1800). Ihnen folg- ten 1803 die „Idyllen“, weiterhin Balladen, Dramen und Romane, eine Gattung, die sie deswegen bevorzugte, weil sie es liebte, „lang- sam und wohlberechnet die Fortschritte der Empfindungen, die un- merklichen Übergänge in den menschlichen Gemütern mit beobach- tendem Auge zu verfolgen und darzustellen“ („Denkwürdigkeiten aus meinem Leben“ I, 398). Während der Jahre 1815—23 schrieb sie eine Reihe von Erzählungen, in denen sie sich schon 1804 und 1805 versucht hatte. Sie erschienen vornehmlich zuerst in Almanachen, |
| |