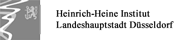| [GAA, Bd. I, S. 604] gen, Cotta 1854, S. 175.) Heine schließlich läßt ihn in Caput XVIII des „Atta Troll“ (1843) in der wilden Jagd, auf einem Esel reitend, als Begleiter Shakespeares erscheinen, und spricht auch in seiner Abhandlung über „Shakespeares Maedchen und Frauen“ (1839) sehr ergötzlich von Horns Kommentare (Insel-Ausgabe, Bd 8, S. 175 f.). Vgl. Lisel Grützmacher, „Franz Horn, ein Nachfahre der Romantik. Ein Beitrag zur Geschichte des literarischen Geschmacks“ (Münster in Westfalen, Phil. Diss. v. 28. Febr. 1927), Münster-Westfalen, Münstersche Buchdruckerei und Verlagsanstalt (1928), darin über die „Erläuterungen zum Shakespeare“ S. 184—91.  S.245, Z.27: Ernst Schulze: (1789—1817), der frühverstorbene Sänger der S. 257, Z. 35 verspotteten „Bezauberten Rose“. Er hatte 1812 promoviert, sich sodann als Privatdozent für philologische Fächer an der Universität zu Göttingen habilitiert und während der beiden folgenden Jahre als freiwilliger Jäger an den Befreiungs- kämpfen teilgenommen. 1813 trat er zuerst mit zwei selbständigen Werken hervor, den „Gedichten“ und den Stanzen „Cäcilie. Eine Geisterstimme“. 1816 bewarb er sich um den vom Brockhaus'schen Verlage in Leipzig als dem Herausgeber des Taschenbuches „Urania“ für die beste poetische Erzählung ausgesetzten Preis mit seinem bereits im Januar des Jahres begonnenen, in drei Gesänge geglieder- ten romantischen Gedichte „Die bezauberte Rose“, in der Strophen- form der Ottaverime geschrieben. Am 29. Juni 1817 erlag er einem Lungenleiden, durch die Strapazen des Feldzuges beschleunigt, nach- dem er nur wenige Tage zuvor die Nachricht von der Krönung seines Werkes erhalten hatte. Dieses erschien zuerst in der „Urania“ für 1818, im selben Jahre auch gesondert, lag 1822 bereits in dritter Auflage vor und hat deren im Verlauf der Jahrzehnte noch mehrere erlebt. Eduard Gehe (siehe die S.245, Z.27: Ernst Schulze: (1789—1817), der frühverstorbene Sänger der S. 257, Z. 35 verspotteten „Bezauberten Rose“. Er hatte 1812 promoviert, sich sodann als Privatdozent für philologische Fächer an der Universität zu Göttingen habilitiert und während der beiden folgenden Jahre als freiwilliger Jäger an den Befreiungs- kämpfen teilgenommen. 1813 trat er zuerst mit zwei selbständigen Werken hervor, den „Gedichten“ und den Stanzen „Cäcilie. Eine Geisterstimme“. 1816 bewarb er sich um den vom Brockhaus'schen Verlage in Leipzig als dem Herausgeber des Taschenbuches „Urania“ für die beste poetische Erzählung ausgesetzten Preis mit seinem bereits im Januar des Jahres begonnenen, in drei Gesänge geglieder- ten romantischen Gedichte „Die bezauberte Rose“, in der Strophen- form der Ottaverime geschrieben. Am 29. Juni 1817 erlag er einem Lungenleiden, durch die Strapazen des Feldzuges beschleunigt, nach- dem er nur wenige Tage zuvor die Nachricht von der Krönung seines Werkes erhalten hatte. Dieses erschien zuerst in der „Urania“ für 1818, im selben Jahre auch gesondert, lag 1822 bereits in dritter Auflage vor und hat deren im Verlauf der Jahrzehnte noch mehrere erlebt. Eduard Gehe (siehe die  Anm. zu S. 252, Z. 4) hat es zu dem Textbuch der von Joseph Wolfram vertonten Oper „Maja und Alpino oder Die bezauberte Rose“ verarbeitet, das 1826 im Druck erschienen ist. Schulzes „sämmtliche poetische Werke“ (4 Bände, 1818 bis 20) hat sein Lehrer und Freund Friedrich Bouterwek besorgt. Die beiden ersten Bände füllt die „Cäcilia, ein romantisches Ge- dicht in zwanzig Gesängen“, begonnen im Januar 1813, vollendet am 18. Dezember 1815. Es feiert den Sieg der christlichen Deut- schen über die noch im Heidentum befangenen seeräuberischen Dänen. Eine starke Abhängigkeit von Tassos „Befreitem Jerusa- lem“ ist darin unverkennbar. Daneben machen sich auch Einflüsse Dantes geltend, mit dem der eifrige Freund italienischer Literatur umso vertrauter war, als ihn auch persönliche schmerzliche Ent- täuschungen zu ihm hinführen mußten. Hatte er doch gleich nach dem Tode der von ihm schwärmerisch geliebten Cäcilie Tychsen, einer Tochter des Hofrats und Orientalisten T. an der Göttinger Universität, ja an ihrem Sterbebette selbst, die Idee eines großen poetischen Werks gefaßt, sie auf eben die Weise zu feiern, wie Dante seine Beatrice oder Petrarca seine Laura. „Die bezauberte Rose“ ist Cäciliens jüngster Schwester Adelheid gewidmet, zu der den Dichter eine unerwiderte Neigung hinzog. Je aussichtsloser seine Bemühungen um die Geliebte wurden, desto mehr lebte er sich in den „Kultus einer unirdischen, hehren, mystischen Liebe“ hinein, Anm. zu S. 252, Z. 4) hat es zu dem Textbuch der von Joseph Wolfram vertonten Oper „Maja und Alpino oder Die bezauberte Rose“ verarbeitet, das 1826 im Druck erschienen ist. Schulzes „sämmtliche poetische Werke“ (4 Bände, 1818 bis 20) hat sein Lehrer und Freund Friedrich Bouterwek besorgt. Die beiden ersten Bände füllt die „Cäcilia, ein romantisches Ge- dicht in zwanzig Gesängen“, begonnen im Januar 1813, vollendet am 18. Dezember 1815. Es feiert den Sieg der christlichen Deut- schen über die noch im Heidentum befangenen seeräuberischen Dänen. Eine starke Abhängigkeit von Tassos „Befreitem Jerusa- lem“ ist darin unverkennbar. Daneben machen sich auch Einflüsse Dantes geltend, mit dem der eifrige Freund italienischer Literatur umso vertrauter war, als ihn auch persönliche schmerzliche Ent- täuschungen zu ihm hinführen mußten. Hatte er doch gleich nach dem Tode der von ihm schwärmerisch geliebten Cäcilie Tychsen, einer Tochter des Hofrats und Orientalisten T. an der Göttinger Universität, ja an ihrem Sterbebette selbst, die Idee eines großen poetischen Werks gefaßt, sie auf eben die Weise zu feiern, wie Dante seine Beatrice oder Petrarca seine Laura. „Die bezauberte Rose“ ist Cäciliens jüngster Schwester Adelheid gewidmet, zu der den Dichter eine unerwiderte Neigung hinzog. Je aussichtsloser seine Bemühungen um die Geliebte wurden, desto mehr lebte er sich in den „Kultus einer unirdischen, hehren, mystischen Liebe“ hinein, |
| |