G. P. M. Vor Allen muß ich bemerken, daß die Vorstellung an Serenissimum mir gewiß mehr Lob gibt, als ich verdiene, und ich 30die geneigte Gesinnung darin dankbar verehre. Zum ersten Bogen derselben pag. 3 und 4 wage ich anzuführen, daß nicht bloß auf der Universität, sondern schon auf der Schule die Geschichte und die Geographie, wie meine Lehrer: Falkmann, Möbius, Preuß, bezeugen müssen, mein 35Haupt- und Lieblings-Studium war, ich auch darin etwas prästirte. [GAA, Bd. V, S. 119]
Actenstaub und Actendunst fürchte ich so wenig, daß ich allein in der letzten Zeit drei Bibliotheken (die Helwing-Hoffmannische, die Helwingische und die dem Auditor Krohn von seinem Vater nachgelassene) binnen wenigen Tagen geordnet 5habe, welches zugleich ein Zeugniß geben möchte, daß ich in den dazu erforderlichen Kenntnissen einiges Zutrauen genieße. Jetzt habe ich von dem General-Superintendenten Werth den Auftrag erhalten, morgen den 28. August eine meist 10theologische Büchersammlung zu verauctioniren, und dabei abermals Gelegenheit bekommen, den literarischen Nachlaß des verstorbenen General-Superintendenten von Cölln ordnen zu helfen. Den Advocatenstand zu verlassen trage ich herzliche Sehnsucht, 15habe auch stets an der Jurisprudenz nur die historischtheoretische Seite geliebt, und ging zum Theil deßhalb nach Leipzig und Berlin, wo, besonders unter Haubold, die historische Schule vorherrschte. Zum 2ten Bogen pag. 4 ect. der Vorstellung. 20 Diplomatik betreffend, wurde dieselbe in Leipzig nur als Nebensache der historischen und historisch-juristischen Collegien betrachtet, und kam, weil man sich auf den eignen Trieb der Fähigen von Seiten der Oberbehörden verließ, kein Collegium darüber zu Stande. Wie in Leipzig, steht es damit auch 25an den übrigen Universitäts-Orten und es ist jetzt bloß leeres Rühmen zu sagen, Diplomatik gehört zu haben. Eben durch die Praxis selbst, fundirt auf Geschichtskenntniß, läßt sich in diesem Felde heut zu Tage etwas erwerben, und wo sollte ich eine bessere Anleitung finden, als wenn ich das Glück 30hätte, unter den Augen des Herrn Archivraths zu arbeiten? Das ist mehr als Universität und gerade darum ist zu hoffen, daß der Fürst die geschehene Bitte, welche ihm einen tüchtigen Geschäftsmann im Gewährungsfalle bilden würde, unter solchen Auspicien gewährt. 35 Das Nächste, was im Ermangelungsfalle zu haben war, habe ich nicht versäumt: vor allem hörte ich (was sonst kein Student so früh thut, noch mit Nutzen thun kann,) schon im 2ten Halbjahr bei dem alten Professor Müller alt- und neudeutsches, lausitzisches und sächsisches Lehn- und Staatsrecht, 40in welchem durch natürliche Verbindung ein ganzer diplomatischer politischer Cursus vorkam, besonders ein fortwährender [GAA, Bd. V, S. 120]
Bezug auf die alten Manuscripte zu Halle, Leipzig und Görlitz. Bogen 3 der Vorstellung. Bei dem Sohn des Hofraths Wenk (ebenfalls ein historischer 5Jurist) hörte ich viele Collegia. Geschichte im Allgemeinen und die der größern Staaten betreffend, ist wohl seit meinem 17ten Jahre keine Woche bis zur gegenwärtigen vergangen, wo ich nicht in verschiedenen Sprachen wenigstens drei bis vier Bände guter Schriften darüber studirt habe. Dies 10ist in der Stadt wohl eben nicht unbekannt, ich bin aber jedenfalls erbötig, das strengste Examen stündlich darüber gegen mich ergehen zulassen. Ja, wird es irgend bedungen, so kann ich hoffen, mich binnen Kurzem, oder sofort, zum s. g. Doctor, eigentlich Magister, 15der historischen Classe einer philosophischen Facultät erheben zu können, was ich bloß unterlassen habe, weil man einestheils den Doctorhut mit Recht hier nicht respectirt, anderntheils zu viel Kosten bevorstanden. Geschichtliche Collegien hörte ich bei: Pölitz, Kruse (in 20Leipzig, Verf. der Tabellen und Karten über das Mittelalter), Beck, Böttiger (jetzt nach Erlangen berufen), Wieland, Wilkens, fast aus allen Zeiträumen, — gestehe aber dabei, daß ich in diesen Collegien, für die Masse berechnet, nichts Neues erfuhr, und eben deßhalb mein Studium auf meinen Privatfleiß, 25dessen Früchte ich gern durch ein Exa- men documentiren würde, immermehr zurückziehen mußte. Mit dem Professor Raumer in Berlin (Verf. der Hohenstaufen) ward ich persönlich bekannt. Eben dieser Bekanntschaft mit dem Professor Wendt in 30Leipzig, unter welchem die Universitätsbibliothek mit ihren Manuscripten steht, mit dem Bürgermeister und Hofrath Blümner daselbst, der über die Rathsbibliothek gebietet, verdanke ich nicht den kleinsten Theil einer im Ganzen vielleicht unbedeutenden historisch-literarischen Bildung. 35 In Dresden vollends, wo die zahlreichste und manuscriptenvollste Büchersammlung Deutschland's sich befindet, hatte ich nicht nur die tägliche Gelegenheit, dieselbe zu benutzen, sondern erhielt im Gespräch mit dem Prof. Kruse (aus Halle), mit dem Hofrath Tieck, der viele Lebensjahre bloß dem 40Studio des Mittelalters widmete, auch mit v. d. Hagen (aus Breslau) die belehrendsten Ermunterungen. [GAA, Bd. V, S. 121]
Die Lippische Geschichte betreffend muß ich dieselbe schon wegen vieler juristischer Fälle möglichst studiren, kann aber, bei Ermangelung vollständiger Schriften, wiederum eben nur unter Anleitung des Herrn Archivraths das Genügende lernen, 5er ist der Einzige, der dabei Aufschluß geben kann. Ueber meine juristischen Kenntnisse beziehe ich mich nöthigen Falls auf die hiesigen Obergerichte, besonders da ich glauben darf, daß die ersteren wirklich jährlich zunehmen. Auch glaube ich, ein Archivar, der kein guter Jurist wäre, ist nicht 10denkbar. Die Zeiten sind so, daß die Vereinigung eines Juristen, Historikers und sprachlich gebildeten Mannes, welche Dreiheit sich wohl nirgends besser als mit der Hülfe des Herrn Archivraths Clostermeier erwerben läßt, von Ersprießlichkeit seyn dürfte. 15 Alles dies ist nur zum beliebigen Ansehen hingesetzt, und es wird um Verzeihung gebeten, wenn der Ton hier und da zu stark scheinen sollte, was so leicht eintritt, wenn man von sich reden muß.
|
  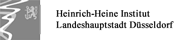 | © 2009—2011 by Lippische Landesbibliothek - Theologische Bibliothek Detmold, Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier und Heinrich-Heine-Institut Düsseldorf Home | Impressum | Kontakt |

99.
H: nicht bekannt.
D: an dem bei
S. 120, Z. 14: sofort] so fort D
[Bd. b5, S. 494]
S. 120, Z. 15: Facultät] Falcultät D [Drf.]
S. 121, Z. 20: Grabbe] Grabbe D
In D S. 128—29 werden die zwischen den beiden Briefen an
Clostermeier liegenden Ereignisse wie folgt geschildert:
„Nach einer erfolgten Einladung erschien nun Grabbe bei
Clostermeier, und sprach ihm dabei persönlich in einer Bewegung
sonderngleichen seinen höchsten Wunsch und seine innige
Bitte aus.
(Zwei, dem ersteren noch nachgefolgte Schreiben, worin Grabbe
seine lebendigen Empfindungen niedergelegt, sind schon vor längerer
Zeit abhanden gekommen.)
Clostermeier suchte nun Grabbe's Kenntnisse im Laufe
der Unterhaltung zu erforschen und nahm bei Dessen von da an
oft wiederholten Besuchen, ernste Prüfungen mit ihm vor, aus
welchen er der Ueberzeugung immer näher kam, daß Grabbe
bei fortwährendem Fleiß in kurzer Zeit bald allen Forderungen,
welche man an einen Archivar zu machen habe, entsprechen werde.
In dieser Ueberzeugung konnte Clostermeier nicht anders, als Grabbe
den Vorzug vor Andern einräumen, welche sich persönlich schon
früher mit ähnlichen Wünschen an ihn gewendet hatten, — ein
Vorzug, welcher Grabbe ausnehmend erfreute.
Eine neue schwere Krankheit, von welcher Clostermeier
hierauf befallen wurde, hatte ihn erst im August ein umständliches
Promemoria in Betreff seiner Amtsnachfolge am Archiv entwerfen
lassen; und da die schmerzhafte Krankheit keine Besuchsannahme
gestatten konnte, so wurde Grabbe die Vorstellung zur Ansicht
mitgetheilt, worauf er unter dem 27. August Clostermeier folgendes
Promemoria übersandte.“
S. 119, Z. 2: drei Bibliotheken (die Helwing-Hoffmannische, die
Helwingische: Am 31. Oktober 1825 war die verwitwete Präsidentin
von Hoffmann zu Brake im fünfundsiebzigsten Jahre ihres Alters
verstorben und Termin zur Eröffnung des von ihr und ihrem Ehemanne,
weiland Präsident von Hoffmann, gemeinschaftlich errichteten
Testamentes auf den 1. Dezember angesetzt worden. Die Todesanzeige
ist unterzeichnet von: Wilhelmine Helwing, Friedrich Wilhelm
Helwing, Wilhelm von Hoffmann und Lotte von Hoffmann.
(Vgl. „Fürstlich Lippisches Intelligenzblatt“ Nr 45, 5. Nov. 1825,
S. 357, u. Nr 47, 19. Nov. 1825, S. 372.)
S. 119, Z. 3 f.: dem Auditor Krohn von seinem Vater nachgelassene:
Siehe die Anm. zu
S. 119, Z. 17: Haubold: Siehe die Anm. zu
S. 119, Z. 22—24: und kam [...] kein Collegium darüber zu
Stande: Diese Angabe ist nicht ganz glaubhaft. Sicher ist zum mindesten,
daß Dr. Carl Rüffer an der Leipziger Universität sowohl
für das Sommersemester 1820 wie für das Wintersemester 1820 auf
21 eine zweistündige Vorlesung über „artem diplomaticam ut subsidiariam
iurisprudentiae doctrinam in usum studiosorum iuris (ex
suis thesibus)“ angekündigt hat. Daß sie das eine oder andere
Mal auch zustande gekommen sei, kann freilich nicht behauptet
werden.
[Bd. b5, S. 495]
S. 119, Z. 38: bei dem alten Professor Müller: Siehe
25—35, sowie die Anm. zu
S. 120, Z. 4: Hofraths Wenk: Friedrich August Wilhelm Wenck
(1741—1810) wurde 1771 außerordentlicher, 1779 ordentlicher Professor
der Philosophie an der Leipziger Universität. Am 2. Oktober
1780 erhielt er, mit dem Charakter eines Hofrats, die ordentliche
Professur für Geschichte, die er bis zu seinem Tode innegehabt hat.
S. 120, Z. 19: Pölitz: Siehe
zu
Während Grabbes Leipziger Aufenthalt hat er folgende geschichtliche
Vorlesungen angekündigt: Im Winter-Semester 1820 auf 21:
Geschichte des europäischen Staatensystems in den drei letzten Jahrhunderten
aus dem Standpunkte der Politik; im Winter-Semester
1821 auf 22: dasselbe von 1492 an.
S. 120, Z. 19 f.: Kruse (in Leipzig [usw.]): Christian (Karsten)
K. (1753—1827) bekleidete von 1811 an bis zu seinem Tode die
Professur der historischen Hilfswissenschaften an der Universität
Leipzig. Sein bedeutendstes Werk, das Ergebnis einer vierzigjährigen
Arbeit, ist sein großer „Atlas zur Uebersicht der Geschichte aller
Europäischen Staaten von ihrem Ursprunge bis zum Jahre 1800“,
dessen erste Lieferung 1802 erschien, der 1818 beendet und von dem
schon 1822 eine zweite Ausgabe notwendig war.
Während Grabbes Leipziger Aufenthalt hat er folgende geschichtliche
Vorlesungen angekündigt: Im Winter-Semester 1820 auf 21:
Leben Cicero's und Geschichte der Römer von den Gracchischen
Unruhen bis zur Schlacht bei Actium; im Sommer-Semester 1821:
Geographie und kurze Geschichte der Juden; im Winter-Semester
1821 auf 22: Leben Cicero's und Geschichte der Römer von den
Gracchischen Unruhen bis zur Schlacht bei Actium.
S. 120, Z. 21: Beck: Christian Daniel B. (1757—1832) wurde
1782 außerordentlicher, 1785 ordentlicher Professor graecarum et
latinaraum litterarum an der Leipziger Universität. 1819 trat er
diese Stelle ab und übernahm die Professur der Geschichte, die er
als Universalgeschichte und als Geschichte einzelner neuerer Staaten
vortrug.
Während Grabbes Leipziger Aufenthalt hat er folgende geschichtliche
Vorlesungen angekündigt: Im Sommer-Semester 1820: Allgemeine
Geschichte vom Anfange bis zur Entstehung neuer Reiche,
843 J. n. Chr. nach seinem Grundriß; Geschichte von Frankreich,
Großbritannien und den Freystaaten Nordamerika's, öffentlich; im
Winter-Semester 1820 auf 21: Mittlere und neuere Universalgeschichte,
nach seinem Entwurf der drei letzten Perioden; Geschichte
Großbritanniens und der Vereinigten Staaten von Nordamerika;
im Sommer-Semester 1821: Allgemeine Welt- und Völkergeschichte
von Erschaffung der Welt bis auf die Teilung der Karolingischen
Monarchie im Jahre 843, nach seiner kurzgefaßten Anleitung zur
Welt- und Völkergeschichte; Allgemeine christliche Kirchengeschichte
für Studierende aller Fakultäten, nach seinen Sätzen; im Winter-Semester
1821 auf 22: dasselbe; Allgemeine Geschichte vom Untergange
des abendländischen Kaisertums bis auf die neuesten Zeiten,
nach seinem Entwurfe.
[Bd. b5, S. 496]
S. 120, Z. 21: Böttiger: Karl Wilhelm B. (1790—1862) wurde
1819 außerordentlicher Professor für Geschichte in Leipzig, aber
bereits 1821 als Ordinarius nach Erlangen berufen.
Während Grabbes Leipziger Aufenthalt hat er folgende geschichtliche
Vorlesungen angekündigt: Im Sommer-Semester 1820: Geschichte
der französischen Revolution vom Jahre 1787 an, nach
seinen Sätzen, unentgeltlich; Geschichte des Königreichs Sachsen,
nach Pölitz, öffentlich; im Winter-Semester 1820 auf 21: Geschichte
des Königreichs Sachsen; Geschichte des deutschen Reichs und Volks,
nach Pölitz; im Sommer-Semester 1821: Geschichte des Königreichs
Sachsen.
S. 120, Z. 21: Wieland: Ernst Karl von W. (1755—1828) wurde
1779 außerordentlicher Professor der Philosophie an der Universität
Leipzig, trat aber 1803 in preußische Dienste über. Nach sechs
Jahren wurde er als ordentlicher Professor der historischen Hilfswissenschaften
nach Leipzig zurückberufen und leistete dem auch
folge. 1811 wurde er ordentlicher Professor der Geschichte und blieb
es bis zum Jahre 1819. Dann erhielt er auf eigenen Wunsch seine
Entlassung; auch wurde ihm eine ordentliche Professur der Philosophie
übertragen. Seine Kollegs hat er weiterhin gelesen.
Während Grabbes Leipziger Aufenthalt hat er folgende geschichtliche
Vorlesungen angekündigt: Im Sommer-Semester 1820: Allgemeine
Geschichte nach seinen Sätzen; im Winter-Semester 1820 auf 21:
Geschichte von Frankreich, nach Meusel; Allgemeine Weltgeschichte,
nach eigenen Sätzen; im Sommer-Semester 1821: Geschichte von
Dänemark und Schweden nach Meusel; Allgemeine Weltgeschichte
nach eignen Sätzen; im Winter-Semester 1821 auf 22: Allgemeine
Weltgeschichte nach eignen Sätzen.
S. 120, Z. 21 f.: Wilkens: Ein Professor Wilkens hat während
des in Frage kommenden Zeitraums weder der Leipziger noch der
Berliner Universität angehört. Gemeint ist offenbar Friedrich Wilken
(1777—1840), der Geschichtsschreiber der Kreuzzüge, der seit
1817 die Professur der Geschichte und der orientalischen Sprachen
an der neubegründeten Berliner Hochschule innehatte.
S. 120, Z. 27: Professor Raumer: Siehe
S. 120, Z. 29: Professor Wendt: Siehe die Anm. zu
Daß er in jenen Jahren die Universitätsbibliothek in Leipzig geleitet
habe, ist eine irrige Behauptung. Ihr Direktor war vielmehr
von 1790 bis 1832 Christian Daniel Beck.
S. 120, Z. 31 f.: Hofrath Blümner [usw.]: Siehe die Anm. zu
ihm zwar zugedacht gewesen, er hat es jedoch noch vor erfolgter
Wahl abgelehnt. Richtig ist dagegen, daß er der Leipziger Ratsbibliothek
vorgestanden habe. Ob Grabbe die Bekanntschaft Blümners
bereits während seiner Leipziger Studienjahre gemacht hat, wie
Ziegler (S. 57) berichtet, oder ob sie nicht vielmehr erst durch diejenige
mit Amadeus Wendt vermittelt worden ist, muß dahingestellt
bleiben.
S. 120, Z. 38: Prof. Kruse (aus Halle): Friedrich Karl Hermann
K. (1790—1866) hatte von 1821 bis 1828 die Professur der alten
[Bd. b5, S. 497]
und mittleren Geschichte zu Halle inne. Siehe auch die folgende
S. 120, Z. 40 f.: v. d. Hagen: Friedrich Heinrich von der H.
(1780—1856) war seit dem Jahre 1818 ordentlicher Professor der
deutschen Sprache und Literatur an der Universität Breslau. —
Daß Grabbe seine persönliche Bekanntschaft wie diejenige Kruses
gemacht habe, ist sonst nicht bezeugt. Es ist auch nicht möglich
gewesen, zur Kontrolle der Angabe Grabbes festzustellen, ob der
eine oder andere während des in frage stehenden Zeitraums überhaupt
bei Tieck in Dresden zu Besuch gewesen ist. Köpke, der in
dem, Tiecks Dresdener Zeit gewidmeten Kapitel seiner „Erinnerungen
aus dem Leben des Dichters“ (2. Teil. Leipzig, Brockhaus 1855.
S. 14—28) auch der auswärtigen Gäste Erwähnung tut, weiß davon
nichts zu berichten. Ebenso ergaben, was von der Hagen anlangt,
dessen bei Holtei („Briefe an Ludwig Tieck“, Bd 1, Breslau, Trewendt
1864. S. 265 ff.) mitgeteilte Briefe an Tieck keinerlei Anhaltspunkte.