G. P. M. Anbei die Journale retour. Meine Notizen über Freim. u. Eleg. verlor ich. Im Freim. erinnre ich mich, besonders 15nachdem ich wieder nachgeschlagen, an p. 823, wo ich, Immermann und Uechtritz wie Triumvirat stehen. Quod non. Ein Correspondent des Freim. oder der Eleg. (egal, sie taugen beide nichts, und sind die Widersprüche ihrer Namen) spricht von einem „gewissen Paul Jovius.“ Paul Jovius windbeutelt, 20ist aber viel zu bekannt, um als ein „gewisser“ bezeichnet zu werden. Schuljungencorrespondenz. — Blätter für litt. Unterh. Schröters finnische Runen sind erbärmlich. — p. 1159 [richtig: 1195]: Geschrei über die innere Wärme der Erde? Die ist da, ihr Narren. Kennt ihr keine Keller? — Das 25Blatt hat sich zu schämen, nimmt elendes franz. Romanzeug als historisch auf. p. 1195 ist anno 1613 ein Duell in England, und p. 1196 soll's vorgefallen seyn zur Zeit der Königin Anna das. Ein Irthum um 100 Jahre, wie ihn die Franzosen oft windbeuteln. — Eduard Pöppig über Chile u Peru, sollte 30sein Maul zu und seinen Popo herhalten. Er kalfatert nur längstbekannte Sachen. Beil. nr. 10. „Ihr hoher Wuchs ein langer Frühlingsathem, von Rosenfluren und von Nelkenstaaten “. Na, ist das schön und richtig, sind mir alle meine Bilder im Gothland vergeben. — Fetischis mus, statt Fetischmus 35steht, glaub' ich, p. 1214. Während der Hermannsschlacht schlag' ich's nicht noch einmal nach, das dumme Zeug. — Die Narren! Die Franzosen haben als Geschichtschreiber, wenig gesagt, soviel geleistet als wir Deutschen. Wo ist denn unser Mabillon? Wir sind wie ein Chausseeverschlag oder ein Elegant, [GAA, Bd. VI, S. 296]
und erheben uns immer, um uns tiefer zu erniedrigen. Weg damit. — Die Aufgabe der Dichtkunst ist, den Geist rein zu waschen, Himmel, Erde und Unendlichkeit anzudeuten, und fest in sich zu bleiben. — 1232 Wieder ein erlogner Brief 5der Bouleyn. Was Wunder! Unsere Memoiren lügen den Lebendigen in's Gesicht, warum nicht den Todten? — Boétie, Lammenais. Thun sie doch vor den Kerlen, als merkten sie nicht es seyen elende Wirthshausaushängereien. Und indem ich weiter lese merk' ich, daß deutsche Dummköpfe die französische 10Gaunerei wirklich nicht merken, besonders nicht, wenn sie ein neues Kleid anzieht. — Mit der allgemeinen Encyklopädie geht's krumm, wie man schon vor Jahren wußte. Brockhaus hätte die Nase von einem Unternehmen lassen sollen, welches nur Riesen, die da bezahlt seyn wollen, nicht Conversationsschwätzer 15tragen können. Jetzt bietet er das Hurenkind feil. — Der alte, jammerwerthe Tieck mit seinem Novellengeschwatz, endlich zu Ruhm gelangt, weil er mit Schiller und Goethe nicht auskommen konnte, und leider sie überlebte. — p. 1251 ist der Zweck der Ehe innige Vereinigung der Geschlechter, 20aber keine Kinderzeugung. Schön, man denkt bei der innigen Vereinigung nicht daran, kämen nur die Kindlein nicht von selbst nach. 1256. Beschreibt ein Lump das berühmte Dorf, und weiß nicht, daß es Broek heißt. — Brockhaus und Marx thun mehr als Tieck selbst, um aus dem Kurzbein mehr 25zu machen als es ist. — Morgenbl. Görres, jetzt mit dem Vornamen Guido, hat gute Tendenzen. Sollte aber tiefer in die Sache eindringen, und ergründen, weshalb er 1798 die Jacobinermütze trug und sie jetzt anspeit. Ich liebe Monarchie, aber Görres liebt alles, findet er nur eine Hand, die seinen 30Groschen ausgibt. — Freiligrath hat sein Lebstag keinen Tannenwald in seiner Jugend gesehen. Wir hatten damals nur Buchen u. Eichen im Lande. Doch das wird alles vag genommen. Schofel sey Schofel, nur die Farben grell. [Ein Schnörkel.] Kunstbl. Christus wird noch immer milden Gesicht's gemahlt. 35Wissen die Kerle nicht, was er Palmsonntag vorhatte und weshalb Pilatus eingriff? nr. 81. ist das Geschwätz über Staffage, Landschaft ect. abscheulich. Jeder Ochs, wenn auch nicht ein Recensent, sieht ein, daß man Leben und Umgebung verbinden muß, sonst fräß' er kein Gras. — Teufel, was 40lausen die Blitze p. 336 an den Himmelszöpfen, unseren Kirchen. — Littbl. Es stieß mir dießmal eben nichts drin auf. [GAA, Bd. VI, S. 297]
Daß meine Meinung, daß wir Nordländer eher Indien als Indien uns erobert habe, richtig ist, beweisen wieder die Kabuschaner (p. 406.) Ungeheure chronologische Irthümer sind da. Blätt. a. d. Gwt. Ich habe sie durchgelesen. Mich treibt's 5aber zum Hermann. Auch Schiller anbei mit Dank zurück. Ich las ihn bei Nacht, vielleicht zum tausendstenmal. Er ist doch besser als Goethe, und seine Flecken sind unvermeidliche, ehrliche, nicht mit einem nassen Borstwisch dem Leser in's Gesicht geschleudert, 10wie's „der Kaufmann am Hof und vor dem Publicum“ zu machen wagte.
|
  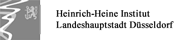 | © 2009—2011 by Lippische Landesbibliothek - Theologische Bibliothek Detmold, Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier und Heinrich-Heine-Institut Düsseldorf Home | Impressum | Kontakt |

667.
H: Doppelbl. in 20; 4 S.
F: Freies Deutsches Hochstift; Frankfurter Goethe-Museum.
Nr 2310.
T: Willkomm S. 73.
D: Unter der Überschrift „Ein Brief Grabbes“ (= Spiegelungen
aus älterer und jüngerer Zeit. 2.) in: „Athenäum. Zeitschrift für das
gebildete Deutschland“, red. von Dr. Karl Riedel, Jg. 1, No 36,
11. September 1841, S. 560—61. — Ein Auszug daraus unter der
Überschrift „Grabbe als Kritiker“ 1. in: Rosen-Literaturblatt. No
38. 25. Sept. 1841. Sp. 302—303. 2. in: „Der Humorist“ von
M.[oritz] G.[ottlieb] Saphir, Jg. 5, Nr. 196, 1. Oktober 1841,
S. 808.
S. 295, Z. 29: Pöppig über] Grabbe hat die erste Seite des Briefes
mit dem Kustos ü- beendet, die zweite versehentlich nochmals mit
Pöppig begonnen.
S. 296, Z. 8: Wirthshausaushängereien] Wirthshansaushängereien H
S. 296, Z. 35: er] fehlt H
S. 297, Z. 2: richtig ist] fehlt H
S. 297, Z. 7: tausendstenmal] tausendstmal H
S. 295, Z. 14—16: Im Freim. erinnre ich mich [usw.]: „Der
Freimüthige“ Nr 205. 15. October. S. 822—23: „Kritische Seitenblicke
auf die moderne Komik und modernes Theater. [Unterz.:]
H.[ermann] M.[arggra]ff.“ Dieser behandelt u. a. die damals vielerörterte
Entfremdung zwischen dichterischer Produktion und Reproduktion,
die Bevorzugung der Oper, des Lustspiels und des Ballets
bei Publikum und Intendanz, wodurch eine Unmenge aufstrebender
dichterischer Kraft brachgelegt sei. In diesem Zusammenhange
schreibt er (S. 823): „In einsiedlerischer Entfernung führen Grabbe,
Immermann und Uechtritz ihr dramatisches Leben.
Sie fürchten die Kabale der Directionen, die Harthäutigkeit des
Parquets, die Geschmacklosigkeit der ersten Ranglogen.“
S. 295, Z. 16: Quod non: Warum nicht.
S. 295, Z. 16—21: Ein Correspondent des Freim. oder der Eleg.
[usw.]: Ebenda S. 824: Die letzte der „Rückblicke“ überschriebenen
geschichtlichen Notizen von B. berichtet von der Wut, mit der
man in früherer Zeit das Horoskop gestellt habe; einige hätten
sich damit sogar an die Person Christi herangewagt. „Nach solcher
Frechheit — so lautet der letzte Satz — kann es nicht mehr befremden,
daß ein gewisser Paulus Jovius Luthers Ketzerei aus den Sternen
erkennen wollte.“ — Gemeint ist der italienische Geschichtsschreiber
Paolo Giovio, geb. am 19. April 1483 in Como, gest. am
11. Dezember 1552 in Florenz. Ursprünglich praktischer Arzt in
Mailand, ging er um das Jahr 1517 nach Rom, um der Historiograph
seiner Zeit zu werden. Seine unter dem Namen Paulus Jovius herausgegebenen
„Historiarum sui temporis libri XLV“ (2 Bde. Florenz
1550—52) behandeln die Geschichte von 1494 bis 1547. — Vgl. auch
S. 295, Z. 21 f.: Blätter für litt. Unterh. Schröters
finnische Runen [usw.]: „Blätter für literarische Unterhaltung“ Nr
[Bd. b6, S. 752]
288—89. 15. u. 16. Oktober: Besprechung des Werkes „Finnische
Runen. Finnisch und deutsch von H.[ans] R.[udolf] von Schröter.
[2. Aufl.] Herausgegeben von G.[ottlieb] H.[einrich] von Schröter.
Mit einer Musikbeilage. Stuttgart, Cotta. 1834.“ Von 3.
S. 295, Z. 23 f.: p. 1159 [richtig: 1195]: Geschrei über die innere
Wärme der Erde [usw.]: Ebenda Nr 290. 17. Oktober. S. 1195:
Rezension der „Beobachtungen über die Temperatur des Gesteins in
verschiedenen Tiefen in den Gruben des sächsischen Erzgebirges in
den Jahren 1830—1832, angestellt auf Anordnung e. k. s. hochverordneten
Oberbergamts und zusammengestelllt von F.[erdinand]
Reich. [...] Freiberg, Engelhardt. 1834.“ Von 20. Sie beginnt:
„Die vorliegende Schrift gibt Beiträge zur Beantwortung einer sehr
interessanten Frage. Wie viel ist schon darüber gestritten worden,
ob die Erde eine von der Sonnenwärme unabhängige innere Wärme
habe, oder nicht, und noch mehr darüber, wo dieser Quell
der Wärme, wenn er wirklich vorhanden, zu suchen sei. Eine eigenthümliche
Erdwärme selbst wird nun wol heutzutage nicht mehr abgeleugnet
werden können, [...].“ Es folgt eine Erörterung der Gründe
und Gegengründe. — Reich (1799—1883), der zu jener Zeit Berg-Akademieinspektor
und Professor der Physik in Freiberg war, ist
als Physiker und Chemiker durch eine bedeutende Zahl ausgezeichneter
Untersuchungen bekannt geworden. Was im besonderen die genannte
Schrift angeht, so ist sie das Ergebnis einer sehr wichtigen
und mit großer Sorgfalt durchgeführten Reihe von Beobachtungen,
welche die Frage beantworten sollten, ob die Erdwärme mit der
Tiefe zunehme. Das von ihm abgeleitete Endresultat ist, daß auf
je 41,84 Meter oder 128,9 Pariser Fuß Tiefenzunahme eine Wärmezunahme
von 10 in den angegebenen Gesteinsschichten stattfindet.
(Vgl. K., ADB Bd 27, S. 607—11.)
S. 295, Z. 24—29: Das Blatt hat sich zu schämen [usw.]: Ebenda
Nr. 290—91. 17. u. 18. Oktober: „Ein Duell im Jahre 1613.“ Nach
einem französischen Blatte mitgeteilt von 150. In diesem Beitrage
wird von einem Duell berichtet, in dem Edward Lord Bruce von
Sackville, Sohn des Grafen von Dorset, seinem ehemaligen Freunde
und Bruder seiner Braut, getötet wird. Beide Duellanten waren
Pagen am Hofe Jakobs VII. (1685—1689) gewesen. Der Königin
Anna von England wird auf S. 1196 dergestalt Erwähnung getan,
daß es von Clementinen, der Schwester Sackvilles, heißt, sie sei eine
der größten Schönheiten und glänzendsten Partien an ihrem Hofe
gewesen. Da Anna, aus dem Hause der Stuarts, von 1702—1714
regiert hat, so wird es in der Tat 1713 heißen müssen, wenn die historischen
Fakta stimmen sollen.
S. 295, Z. 29—31: Eduard Pöppig über Chile u. Peru [usw.]:
Ebenda Nr 290—92. 17.—19. Oktober: „Peru. [Unterz.:] Eduard
Pöppig.“ Dieser gibt in seinem Aufsatze eine Übersicht über den
zweiten Band seiner „Reise in Chile, Peru und auf dem Amazonenstrome
während der Jahre 1827—32“. (Leipzig, Hinrichs 1835.) —
Friedrich Ratzel, der auch Pöppigs Reisebeschreibung selbst sehr hoch
bewertet, nennt diese Selbstanzeige den schönsten der kleineren Aufsätze
des Forschers. (ADB Bd 26, S. 426—27.) Eine Übersicht über
den ersten Band seines Werkes mit der Überschrift „Chile“ hatte
[Bd. b6, S. 753]
Pöppig in den Nrn. 72—75 desselben Journals von 13.—16. März
1835 geliefert.
S. 295, Z. 31—34: Beil. nr. 10 „Ihr hoher Wuchs [usw.]: Ebenda.
„Beilage“ Nr 10. 19. Oktober. S. 1205—06: Rezension von „Wamik
und Asra, das ist der Glühende und die Blühende. Das älteste persische
romantische Gedicht, in Fünftelsaft abgezogen von Joseph von
Hammer. Wien, Wallishauser. 1833.“ Von 3. Hammer hat von dem
verloren gegangenen Epos „Wamik und Asra“ des Ansari, eines der
ältesten und größten neupersischen Dichters (gest. 1039) eine türkische
Bearbeitung aufgefunden und dies 6000 Distichen starke Gedicht
zu einem einzigen Gesange zusammengedrängt, aus dem Proben in
die Besprechung eingeflochten sind. Eine von ihnen lautet:
„Es blühten ihre Haar' als Hyacinthen,
Als Edens Rosen ihrer Wangen Pracht;
Narcissen blühten in der Augen Tinten,
Die Stirn als Lotos, die nach Sommernacht
Dem ersten Sonnenstrahl entgegenlacht;
Im Busen glüht und reift ein Paar Granaten,
Beweget hin und her von Lüften sacht;
Ihr hoher Wuchs ein langer Frühlingsathem
Von Rosenfluren und von Nelkensaaten.“ (S. 1205.)
S. 295, Z. 34—36: Feti schismus, statt Fetischmus [usw.]:
Ebenda Nr 294. 21. Oktober. S. 1214—16: Rezension der Schrift:
„Die Fortbildung des Christenthums zur Weltreligion. Eine Ansicht
der höhern Dogmatik von Christoph Friedrich von Ammon. Zweite
Hälfte. Erste Abtheilung. Leipzig, Vogel, 1834.“ Von 49. In einem
ihrer ersten Sätze kommt das Wort Fetischismus vor. Die Bildung
dieses Wortes aus 'Fetisch' (vom portugiesischen 'feitico') und der
Bildungssilbe 'ismus' kann nicht beanstandet werden, da sie korrekt
ist. Heißt es doch auch im Englischen 'fetichism' und im Französischen
'fétichisme'. Vgl. dazu Walter Henzen, „Deutsche Wortbildung“
(Halle/Saale, Niemeyer 1947), S. 188.
Es scheint aber, als ob in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
neben „Fetischismus“ auch die Form „Fetis(s)mus“ üblich
gewesen sei. In der „neuen starkvermehrten u. durchgängig verbesserten
Ausgabe“ von Joachim Heinrich Campes „Wörterbuch zur Erklärung
und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen
fremden Ausdrücke“ (Braunschweig 1813) findet man auf S. 317[a]:
„Fetismus oder Feticismus, der Fetischdienst, Fetischglaube“; in der
„fünften rechtmäßigen, sehr vermehrten u. verbesserten Ausgabe“
von Johann Christian August Heyses „Allgemeinem Fremdwörterbuche
“ (Hannover, Hahn 1829) auf S. 301: „Fetissmus od. Fetischismus,
m. der Fetischdienst, die Verehrung solcher Gegenstände“; in
der achten Auflage von Samuel Friedrich Erdmann Petris „Gedrängtem
Handbuch der Fremdwörter in deutscher Schrift- u. Umgangsprache
“ (Dresden u. Leipzig, Arnold 1838) auf S. 392: „Fetismus
oder Fetischismus, der Fetischdienst oder Fetischglaube“. Auch Ferdinand
Adolf Webers „Erklärendes Handbuch der Fremdwörter, welche
in der deutschen Schrift- u. Umgangssprache gebräuchlich sind“,
[Bd. b6, S. 754]
kennt in der 4. Stereotypauflage (Leipzig, Tauchnitz o. J.) auf
S. 231[a] die Form „Fetißmus“, von der aber auf „Fetischismus“
verwiesen wird. Dasselbe gilt von der zwölften Auflage von Petris
Fremdwörterbuche vom Jahre 1875; vgl. S. 319.
S. 295, Z. 37 — S. 296, Z. 2: Die Narren! Die Franzosen haben
als Geschichtschreiber [usw.]: Ebenda Nr 293—97. 20.—24. Oktober:
Rezension dreier „Schriften von Franzosen über Deutschland“ von
67. Darin findet sich auf S. 1219, am Schlusse der zweiten Fortsetzung,
bei der Besprechung von E.[ugène] Lerminiers Schrift „Audelà
du Rhin“ (2 Bde. Paris 1835) folgende Bemerkung: „Noch
magerer und wo möglich schlechter wird der Artikel: 'L'histoire', abgefertigt.
Der Verf. hätte hier nach unserer Meinung wenigstens die
Gründlichkeit und die Kritik deutscher Geschichtsforschung herausheben
und dann die Ursachen angeben sollen, warum es uns eigentlich
noch an Geschichtschreibern im höhern Sinne des Wortes fehlt.
Es wäre da manches Neue und Treffende zu sagen gewesen, und der
Verf. hätte eine herrliche Gelegenheit gehabt, zu beweisen, daß er
Deutschland verstanden hätte. Das fehlt ihm aber grade. Er zählt
die Namen Derer auf, welche sich um deutsche Geschichte und Alterthümer
verdient gemacht haben, verliert sich hierauf in eine nichts
weniger als gehaltvolle Diatribe über den Einfluß der Kant'schen
und Hegel'schen Philosophie auf die Geschichtschreibung; sucht zu
beweisen, daß es Johannes Müller und Schiller als Geschichtschreiber
eigentlich doch zu nichts gebracht hätten, und müht sich endlich
mit der Beantwortung der ganz nutzlosen Frage ab, warum Göthe
nicht Geschichtschreiber geworden? 'Nur erst Revolutionen', ruft er
am Schlusse aus, 'dann wird Deutschland auch Geschichtschreiber haben!'
“ — Jean Mabillon (1632—1707), ist berühmt vor allem wegen
seiner kirchenhistorischen Forschungen und als Begründer der wissenschaftlichen
Urkundenlehre, deren Grundsätze er in dem klassischen
Werke „De re diplomatica“ (Paris 1681; nebst Supplement,
1704) niedergelegt hat. — Vgl. zu dieser Stelle auch die Anmerkung
zu
S. 296, Z. 4—6: 1232 Wieder ein erlogner Brief der Bouleyn
[usw.]: Ebenda Nr 298. 25. Oktober. S. 1232: Unter den „Notizen“
wird von 130 ein „Originalbrief der unglücklichen Anna von
Boulen, den sie vor ihrer Heirath mit dem grausamen Heinrich
an eine Jugendfreundin schrieb“, mitgeteilt.
S. 296, Z. 6—11: Boétie, Lammenais. Thun sie doch [usw.]:
Ebenda Nr 299. 26. Oktober. S. 1235—36: „Frankreichs Abraham a
Santa Clara und ein neues Buch von Lamennais.“ Von 29. Dieser
berichtet, daß der Abbé Lamennais, um die französischen, der Verbreitung
liberaler Reformansicht sehr wenig günstigen Prozeßgesetze
zu umgehen, statt einer eigenen eine bereits 300 Jahre alte Schrift
herausgegeben und bloß mit einer Vorrede versehen habe: „De la
servitude volontaire, par Etienne de la Boétie“, der am 1. November
1530 geboren und ein Freund Montaignes gewesen sei. — Daß es sich
bei dem Buche, welches der Theolog und Schriftsteller Félicité Robert
de Lammenais (1782—1854), ein Vorkämpfer demokratischer
Ideen, im Jahre 1835, mit einer Vorrede versehen, neu herausgegeben
hat, in der Tat um Boéties berühmte, im Alter von achtzehn Jahren
[Bd. b6, S. 755]
verfaßte Kampfschrift gegen die Tyrannei: „Le Discours de la servitude
volontaire ou le Contr'un“ handelt, kann im Ernste nicht
bezweifelt werden.
S. 296, Z. 11—15: Mit der allegmeinen Encyklopämie geht's
krumm [usw.]: Ebenda Nr 300. 27. Oktober: Auf S. 1240 zeigt
Brockhaus in Leipzig an, daß von der „Allgemeinen Encyklopädie der
Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten
Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J.[ohann] S.[amuel]
Ersch und J.[ohann] G.[ottfried] Gruber“ wieder einige Teile
erscheinen seien, und daß, um die Anschaffung zu erleichtern, „für
den ersten Ankauf des ganzen Werks sowol, als auch einer Partie
Bände, die billigsten Bedingungen“ gewährt würden. — Das großangelegte
Unternehmen ist bekanntlich unvollendet geblieben.
S. 296, Z. 16—18: Der alte, jammervolle Tieck mit seinem Novellengeschwatz
[usw.]: Ebenda Nr 301. 28. Oktober. S. 1241—44:
„Taschenbücherschau für 1836. Erster Artikel.“ Von 59. Darin S.
1242—44 die Besprechung von Ludwig Tiecks Novelle „Eigensinn
und Laune“ in der „Urania. [Taschenbuch auf das Jahr 1836. Leipzig,
Brockhaus. S. 221—356.]“ Der Referent nennt sie das „Product
eines Tiefsinns, der sich nur mit Hülfe einer beißenden Ironie aus
schwermüthigen Anschauungen über die Menschenwelt und die gegenwärtige
Zeit insbesondere herauszureißen vermag“, und er fährt
fort: „Es ist hier nicht zu entscheiden, ob Tieck die junge Zeit begreift,
aber er greift in sie hinein, und es muß wichtig erscheinen,
sein Augenmerk darauf zu richten, welchen Aufschluß über
seine Gegenwart ein Dichter zu geben versucht, der mit den Wundern
des tiefsten Lebens anderer Zeiten so eng vertraut ist.“ (S. 1242.)
S. 296, Z. 19—22: p. 1251 ist der Zweck der Ehe [usw.]: Ebenda
Nr 303. 30. Oktober. S. 1251: Rezension des Buches „Die Ehe nach
ihrer Idee und nach ihrer geschichtlichen Entwickelung. Ein Beitrag
zur richtigen Würdigung der Ehe und der ehelichen Verhältnisse
(insonderheit der Scheidung und der zweiten Ehe Geschiedener) vom
allgmein-wissenschaftlichen und vom christlich-theologischen Standpunkte.
Von F. Liebetrut. Nebst einem Vorwort von A.[ugust]
Hahn. Berlin, Dümmler. 1834.“ Von 57. Darin heißt es, nahe dem
Anfange: „Mit Recht stellt er das Ideal der Ehe nach christlichen
göttlich verbürgten Begriffen an die Spitze, weil dieses Ideal allein
den richtigen Maßstab zur Beurtheilung ihrer verschiedenen Verhältnisse
an die Hand gibt. Nach ihm ist die Bestimmung der Ehe keine
geringere, als gegenseitige Ergänzung und Vollendung beider Geschlechter
durch innige Vereinigung. Dagegen ist Kinderzeugung nur
ein nachfolender, ein Nebenzweck, nur Wirkung.“
S. 296, Z. 22 f.: 1256. Beschreibt ein Lump das berühmte Dorf
[usw.]: Ebenda Nr 304. 31. Oktober. S. 1256: Das Blatt endet mit
einer Notiz von 130, die mit dem Satze beginnt: „Unweit Amsterdam
liegt ein Dorf, das man in dortiger Gegend schlechthin mit dem
Namen des Dorfes der Millionaire bezeichnet.“ — Es handelt sich
in der Tat — was vielleicht hätte bemerkt werden können — um die
Gemeinde Broek in Waterland (so ist der vollständige Name), in
der viele reiche Kaufherren ihren Wohnsitz hatten.
S. 296, Z. 23—25: Brockhaus und Marx thun mehr als Tieck selbst
[Bd. b6, S. 756]
[usw.]: Worauf sich diese Stelle bezieht und was sie bedeutet, kann
nicht angegeben werden.
S. 296, Z. 25—30: Morgenbl. Görres, jetzt mit dem Vornamen
Guido [usw.]: „Morgenblatt“ Nr 235—49. 1.—17. Oktober: „Das
Narrenhaus, von W.[ilhelm] Kaulbach, nebst Ideen über Kunst und
Wahnsinn. Von Guido Görres. Zweiter Abschnitt. (Mit einem Umriß.)
“ Der Verfasser sieht in den von ihm erdichteten Schicksalen
eines der Wahnsinnigen — es ist der mit dem über die Brust gebundenen
Holzsäbel — das Symbol der Schicksale der französischen Republikaner
vom Anbeginn der Revolution an. Er schreibt in der
ersten Fortsetzung (Nr 236, S. 942—43): „Gerade wie er, so sizt
der gesammte Republikanismus Zerstörung brütend in Paris und ruft
der Welt mit glühenden Blicken zu: könnt' ich, wie wollt' ich! Der
französische Gardist ist sein Bild nach allen seinen verschiedenen Farben,
am frappantesten aber möchte er jener Nüance gleichen, die
eine universale Soldatendemokratie als höchstes Ideal der Menschheit
ausgibt. Fühlten diese Rasenden sich nicht gefangen, wüßten sie nicht,
daß der Eisenmeister mit der Peitsche so nahe stünde, sie würden
ganz anders sprechen oder vielmehr handeln; denn aus ihren Absichten
machen sie schon jezt kein Geheimniß und apotheosiren Robespierre
und Danton zu mythologischen Halbgöttern. Ihre zornigen Liebesblicke
aber gelten vor Allen den gutmüthigen Schafen, die diesseits
des Rheins grasen und aus deren Wolle sie nach altem französischen
Herkommen das Zeug zu ihrem republikanischen Purpur nehmen
möchten. Was sich ihrer Schur im Namen der Freiheit nicht fügen
wollte, würde auf den Kopf geschlagen und dem Boden gleich gemacht,
[...]. Wenn man bedenkt, daß es Republikaner waren, die
beim Tode Lafayettes mit einer Freude, die Hyänen Ehre gemacht
hätte, ihr Gefängniß St. Pelagie beleuchteten, weil ein Verräther der
Freiheit mehr gestorben sey, so kann man fragen: wer wird von
unsern schwachherzigen Weltverbesserern frei gesinnt genug seyn, um
Gnade vor ihnen zu finden? Mit den Brandfackeln der Lafayetteschen
Illumination wird man uns aufklären, wenn wir nicht wie Sklaven
vor der neuen Inkarnation der Freiheit anbetend niederfallen und
zitternd jede ihrer despotischen, goldgierigen und ehrsüchtigen Launen
befriedigen.“ —
Grabbe verwechselt den erst 1805 (zu Koblenz) geborenen Guido
Görres mit dessen Vater Josef von Görres (1776—1848). Dieser hatte,
fortgerissen von den Ideen der französischen Revolution, mit denen
er durch den Einzug der Franzosen in seiner Vaterstadt Koblenz im
Jahre 1794 in Berührung gekommen war, einige Jahre hindurch eine
Rolle in dieser Welt gespielt, 1797, gegen Adel, Geistlichkeit und
Despotismus, das bald unterdrückte „Rote Blatt“, im folgenden Jahre
die Zeitschrift „Rübezahl im blauen Gewande“ gegründet, sich aber
nachher, in seinen Erwartungen enttäuscht, dem Ultramontanismus
zugewandt, eine Richtung in der katholischen Kirche, der auch sein
Sohn Guido angehört hat. Dieser hat später (1838), wesentlich durch
seinen Vater angeregt, die „Historisch-politischen Blätter“ ins Leben
gerufen, in denen Politik und Geschichte im ultramontanen Sinne
behandelt wurden.
S. 296, Z. 30—33: Freiligrath hat sein Lebtag keinen Tannenwald
[Bd. b6, S. 757]
[usw.]: Ebenda Nr 237. 3. Oktober. S. 945—46: „Einem Ziehenden
[Unterz.:] F. Freiligrath.“ (In Schwerings Ausgabe Bd 1, S. 21—22.)
Die fünfte Strophe beginnt:
„Das sind die Helden deiner Knabenzeit; —
Die Einsamkeit
Des Tannenwalds durchzogen sie mit dir,
Vasallen schier.“
Grabbes Annahme, daß Lippe der Schauplatz dieses Gedichtes sei,
ist natürlich durchaus willkürlich. Mit der Bemerkung zur damaligen
Bewaldung seiner Heimat ist er aber im Rechte, wie die folgenden
Zitate beweisen können: „Die mehrsten Berge sind mit Eichen- oder
Buchenwaldungen bedeckt.“ („Des Herrn Hofmarschall und Drosten
W.[ilhelm] G.[ottlieb] L.[evin] von Donop Historisch-geographische
Beschreibung der Fürstlichen Lippeschen Lande in Westphalen. herausgegeben
und mit Zusätzen vermehret von dem Herausgeber des Westphälischen
Magazins [Peter Florenz Weddigen].“ 2., verb. Aufl.
Lemgo, Meyer 1790. S. 4.) „Hohe und dichte Buchen [-] und
Eichenwaldungen bedecken fast alle Berge“. („Historisch-geographi-
sches Handbuch des Fürstenthums Lippe“, hrsg. von Friedrich Wilhelm
von Cölln. Leipzig, Engelmann in Komm. 1828. S. 2.) „Das Land ist
[...] zum Theil gebirgig. Dichte Wälder von Eichen, Buchen, und
andern Laubhölzern bedecken den Rücken“. (Johann Heinrich Schikkedanz,
„Das Fürstenthum Lippe-Detmold in geographisch-statistischer
und geschichtlicher Hinsicht.“ Hildesheim 1830. S. 12.) Schickedanz
nennt zwar (a.a.O. S. 18) bei der Behandlung der Holzkultur
des Landes unter dessen vornehmsten Forstbäumen auch die Fichten,
und zwar an zweiter Stelle; immerhin kann dieser Baum einen beträchtlichen
Teil der Waldungen nicht gebildet haben, denn noch im
Jahre 1899 schreibt Heinrich Schwanold: „In den Fürstlichen Forsten
nimmt die Buche etwa 70% der Gesamtfläche ein, die Eiche 10%,
die Fichte 13% und die Kiefer 6%.“ („Das Fürstentum Lippe. Das
Land und seine Bewohner.“ Detmold, Hinrichs 1899. S. 103.)
S. 296, Z. 34—36: Kunstbl. Christus wird noch immer milden
Gesicht's gemahlt [usw.]: „Kunst-Blatt“ Nr 79. 1. Oktober. S. 325
bis 326: Beschluß der „Mittheilung über die neuesten Kunstunternehmungen
in München“. Am Ende der ersten Seite findet sich eine Beschreibung
der Christus-Statue, die [Ludwig] Schwanthaler für die
Ludwigskirche in Arbeit hat. Da heißt es: „Christus, welchem der
Künstler das Buch des Lebens mit dem Anagramm der ewigen Existenz
und Macht, A Ω, in die Hände gegeben hat, so daß er dasselbe,
zeugend und deutend, vor der Brust hält, und das erhaben milde
Haupt segnend und gewinnend vorneigt, ist hier so recht als eine
Verkörperung der Johanneischen Apokalypse dargestellt, [...]“
S. 296, Z. 36—39: nr. 81 ist das Geschwätz über Staffage [usw.]:
Ebenda Nr 81. 8. Oktober. S. 333—35: „Ueber das wechselseitige
Verhältniß landschaftlicher Gegenstände und historischer oder mythologischer
Personen.“ Der Verfasser versucht, die Forderung, daß die
„Einführung historischer oder mythologischer Figuren dem Gehalte
[Bd. b6, S. 758]
einer Landschaft jedesmal streng unterzuordnen“ sei, „damit letztere
als die ungetheilte Hauptsache erscheine, wirke und vorherrsche“,
an dem Beispiele einer Darstellung des Paradieses zu widerlegen. Seine,
im ersten Abschnitte geäußerte Ansicht ist die, daß das Landschaftliche
und Menschliche gleiche Ansprüche behaupte „und die Vollendung
des lebendigen Ganzen durchaus auf der freien, unverkümmerten
Zusammenwirkung der verschiedenen Bestandtheile“ beruhe.
S. 296, Z. 39—41: Teufel, was lausen die Blitze p. 336 [usw.]:
Ebenda S. 336: Die Notiz „Bauwerke“ berichtet über Blitzschläge
in den Turm des Straßburger Münsters, in die Borromäuskirche zu
Rom und in den Turm der alten Ritterholmskirche zu Stockholm.
S. 297, Z. 1—3: Daß meine Meinung, daß wir Nordländer [usw.]:
„Literatur-Blatt“ Nr 102—03. 7. u. 9. Oktober: Ein Bericht über
„Universitätsschriften aus Dorpat“, u. a. die „Dorpater Jahrbücher
für Literatur, Statistik und Kunst, besonders Rußlands, [...] Zweiter
und dritter Band. Jahrgang 1834“ (Riga u. Dorpat, Frantzen). Darin
werden auf S. 406 die „Kaluschaner oder Kubatschiner, ein
kaukasisches Bergvolk, wahrscheinlich germanischen Ursprungs“ erwähnt,
sowie eine unter ihnen verbreitete Sage, nach der ihre Vorfahren
aus Frankistan, d. h. dem westlichen Europa, vor mehreren
Jahrhunderten ausgewandert sein und in den Ländern des Kaukasus
beträchtliche Eroberungen gemacht haben sollen. — Worin sich die
„ungeheuren chronologischen Irrthümer“ zeigen sollen, ist bei dem
durchaus sagenhaften Charakter des Geschilderten nicht ersichtlich.
S. 297, Z. 6: Auch Schiller anbei mit Dank zurück [usw.]: Vgl.
Brief