| Nr. 663, siehe GAA, Bd. VI, S. 291 | 01. November 1835 |  | | Christian Dietrich Grabbe (Düsseldorf) an Carl Georg Schreiner (Düsseldorf) | | Brief | | | | Vorangehend:  | Nachfolgend:  |
|  Ein Rapport. 1.) Wiener Theaterzeitung und Originalblatt. Nichts werth, nicht eine Sylbe die taugt. Das Bild, die Fratze von der Löwe, coquette Geistlosigkeit. nr. 185 singt Langer, und kürzt 25nicht allein Stimme, sondern auch Ungestüm, welches der Kürzung nicht bedurfte. Hätt'st du der „Stimme“ das „e“ gelassen, gäb man dir nicht den Esel mit 2 „e“ retour Eesel. — p. 740. Die Geschichte von Wagener in Leer mit 720_000 Gulden ist wohl im Augarten, nicht in Leer erfunden. — 30Deutschland hat 1814 sicher 6000 Bücher in Druck erscheinen lassen. Man braucht nur der damaligen Flugschriften zu denken. Und die schwatzen von etwas über 1000? Gelbschnäbel. — Und immer schreibt's sich da nicht über, nein: uiber! — p. 750. Anschütz spielt wie ein roher Bauer, Mad. Anschütz 35als wäre sie Syrup. — Ein Rapport. 1.) Wiener Theaterzeitung und Originalblatt. Nichts werth, nicht eine Sylbe die taugt. Das Bild, die Fratze von der Löwe, coquette Geistlosigkeit. nr. 185 singt Langer, und kürzt 25nicht allein Stimme, sondern auch Ungestüm, welches der Kürzung nicht bedurfte. Hätt'st du der „Stimme“ das „e“ gelassen, gäb man dir nicht den Esel mit 2 „e“ retour Eesel. — p. 740. Die Geschichte von Wagener in Leer mit 720_000 Gulden ist wohl im Augarten, nicht in Leer erfunden. — 30Deutschland hat 1814 sicher 6000 Bücher in Druck erscheinen lassen. Man braucht nur der damaligen Flugschriften zu denken. Und die schwatzen von etwas über 1000? Gelbschnäbel. — Und immer schreibt's sich da nicht über, nein: uiber! — p. 750. Anschütz spielt wie ein roher Bauer, Mad. Anschütz 35als wäre sie Syrup. —  In Altona gelten Pandecten. Ein Junge von 12 Jahren ist zurechnungsfähig. Er ist's nach den Pandecten schon mit dem 7. Jahr. — p. 751. Die Tulpen! Daß das Schweinezeug nicht weiß, es waren Wechselzeichen. Wird In Altona gelten Pandecten. Ein Junge von 12 Jahren ist zurechnungsfähig. Er ist's nach den Pandecten schon mit dem 7. Jahr. — p. 751. Die Tulpen! Daß das Schweinezeug nicht weiß, es waren Wechselzeichen. Wird [GAA, Bd. VI, S. 292] jetzt eine Tulpe theuer verkauft, so wird's auch cambium seyn, oder Holländer und Affen, welche die Sache nicht kannten, haben sich die Narrheit einschwatzen lassen, die reichen Banquiers hätten die Tulpenzwiebeln so hoch bezahlt. 5— p. 754. Keinen Referent und der Chemiker aus Dublin keine Mumien, und machen aus einer 3000jährigen Sache eine neue? — 756. Druckfehler oder Dummheit, Zandyck würde sich ärgern: „Deut de midi“ statt „Dent pp. — Hr. Wild sollt's Maul halten. Seine Zunge ist längst schimmlich. 102.) Freimüthige. Hr. Alexis quälen sich zwischen erzwungenem Lob über mich und Ueberschätzung  Immermanns, wozu dieser schwerlich Veranlassung gab, vielmehr hätte der Häring mich ohne Immermann noch mehr ausgeschimpft, aus Neid. Ich habe Immermann nie nachgeahmt. Er eher meinen Napoleon 15in seiner letzten Ausgabe des Hofer. Sonst ist die Kritik dem Absatz nicht nachtheilig. Von Victor Hugo, den ich erst neulich kennen lernte, hab' ich nichts geborgt und verachte die überspannte neuere franz. Schule. Victor hat eher etwas aus meinem Gothland genommen. — Steffens und Herder. Nu, 20so verschieden sie sind, sie taugen beide nichts. Herder quält sich, um etwas herauszubringen, Steffens speit wüstes Zeug aus, wobei seine arme Heimath, Norwegen, und unverdaute erbärmliche Philosophie helfen müssen. — p. 754. Hoffmann von Fallersleben: „was mir bleibt?“ Deine schlechten Verse, 25Fallersleben. — 3.) Litt. Unterh. Heine soff sehr, und die litt. Unt. thuns auch — aus Tintenfässern. — Bettlerzeug das ganze Journal. Ich danke Ihnen, kann indeß nichts mehr lesen, und corrigire am Armin. Immermanns, wozu dieser schwerlich Veranlassung gab, vielmehr hätte der Häring mich ohne Immermann noch mehr ausgeschimpft, aus Neid. Ich habe Immermann nie nachgeahmt. Er eher meinen Napoleon 15in seiner letzten Ausgabe des Hofer. Sonst ist die Kritik dem Absatz nicht nachtheilig. Von Victor Hugo, den ich erst neulich kennen lernte, hab' ich nichts geborgt und verachte die überspannte neuere franz. Schule. Victor hat eher etwas aus meinem Gothland genommen. — Steffens und Herder. Nu, 20so verschieden sie sind, sie taugen beide nichts. Herder quält sich, um etwas herauszubringen, Steffens speit wüstes Zeug aus, wobei seine arme Heimath, Norwegen, und unverdaute erbärmliche Philosophie helfen müssen. — p. 754. Hoffmann von Fallersleben: „was mir bleibt?“ Deine schlechten Verse, 25Fallersleben. — 3.) Litt. Unterh. Heine soff sehr, und die litt. Unt. thuns auch — aus Tintenfässern. — Bettlerzeug das ganze Journal. Ich danke Ihnen, kann indeß nichts mehr lesen, und corrigire am Armin. | Ach, das Datum weiß ich | | Votre | | nicht. Kalt ist's. Verzeihen Sie. | | Grabbe. |
[Düsseldorf, erste Novemberhälfte 1835.] [Adresse:]  Sr Wohlgeboren dem Herrn Buchhändler Schreiner. Mit 1 Mappe u. 4 Journalen. Sr Wohlgeboren dem Herrn Buchhändler Schreiner. Mit 1 Mappe u. 4 Journalen. |
| |


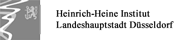


663.
H: Doppelbl. in 20; 3 S., Adresse auf S. 4.
F: GrA
S. 291, Z. 22—24: 1.) Wiener Theaterzeitung [usw.]: „Theaterzeitung“
Nr 186. 17. September. S. 744: „Costüme-Bild Nr. 32
zur Theaterzeitung. Dem. Sophie Löwe, k. k. Hofopernsängerin,
als Prinzessin Isabella in der Oper 'Robert der Teufel' von Mayerbeer.
“ (Nach einer Ranftlschen Zeichnung in Stahl gestochen von
Andre Geiger.) In der folgenden Erläuterung ist die Rede von „ihrer
interessanten Persönlichkeit, dem ausdrucksvollen Gesicht, dem sprechenden
Auge, welche schon gleich im Voraus den Zuschauer fesseln
und ihn für den Gesang und das Spiel der reizenden Künstlerin
noch viel empfänglicher machen.“ — Das fade, ausdruckslose,
puppenhaft-süßliche Lächeln der abgebildeten Sängerin steht in der
Tat zu dieser Beschreibung der lebenden in einem befremdlichen Gegensatze.
S. 291, Z. 24—27: nr. 185 singt Langer [usw.]: Ebenda Nr
185—95. 16.—30. September: „Das Schicksal eines Theaterstückes.
Humoristische Erzählung von Joh. Langer.“ Die Exposition schildert,
wie Rat Werthenfels von seiner Verlobten Pauline überrascht
wird, da er soeben begonnen hat, ein neues Theaterstück zu schreiben:
„Zenobia, Trauerspiel in fünf Handlungen“. Pauline meint,
auch dieses werde doch wieder nur Plan bleiben, wie die früheren.
Werthenfels aber erwidert: „[...] Mein Vorsatz ist fest, Pauline,
ich fühle mich kräftig genug, Melpomenens Priester zu werden:
Ein Zeichen hat der Himmel mir verheißen,
>Ein Schauspiel schreibe!< ruft die inn're Stimm',
Schon seh' ich Helden die Coulissen reißen,
Und brüllen hör' ich sie voll Ungestüm';
Es klagt die Maid, es klirrt der Helm von Eisen,
Und eine Welt stirbt durch des Schicksals Grimm';
Den Ruf der Muse hör' ich, mahnend, klingen,
Pegasus steigt — die Dichtung muß gelingen!
Während Werthenfels den berühmten Monolog der Jungfrau
mit komischem Pathos parodirte [...]“.
S. 291, Z. 28 f.: p. 740. Die Geschichte von Wagener in Leer
[usw.]: Ebenda Nr 185. S. 740: Die Rubrik „Buntes aus der Zeit“
bringt die Geschichte eines Gastwirts Wagener in Leer im Hannöverschen,
der im Jahre 1810 einen von französischen Gensdarmen
verfolgten britischen Agenten unter Gefahr seines Lebens mehrere
Tage lang in seinem Hause verborgen, jede Belohnung des Geretteten
zurückgewiesen habe, kürzlich aber von dem in Westindien verstorbenen
Agenten testamentarisch mit 60_000 Pfund Sterling (720_000
[Bd. b6, S. 741]
fl.) bedacht worden sei. — Augarten: öffentliche Anlagen in der
Wiener Leopoldstadt.
S. 291, Z. 30—32: Deutschland hat 1814 sicher 6000 Bücher
[usw.]: Ebenda eine Mitteilung „Aus der literarischen Welt“ über
die Bücherproduktion in einigen europäischen Ländern. Darin heißt
es von Frankreich: „Im Jahre 1826 hat der Buchhandel 4347 Bücher,
das heißt viermal mehr als 1814 zu Tage gefördert.“ Grabbe hat
also falsch gelesen. — Im Jahre 1814 begann zwar der deutsche
Bücherverkehr, nach sieben Leidensjahren, einen neuen Aufschwung
zu nehmen, immerhin übertrifft aber die von Grabbe genannte Zahl
die wirkliche um reichlich das doppelte. Denn nach Gustav Schwetschkes
„Codex Nundiarius Germaniae Literatae Continuatus“ (Halle,
Schwetschke 1877, S. 341) sind im Jahre 1814 in deutschen Verlagsorten
2754 Bücher erschienen. Dabei ist zweierlei zu berücksichtigen:
einmal, daß Schwetschke zu den deutschen Orten auch alle die rechnet,
„in welchen von alter Zeit her deutsches Leben und deutsche
literarische Kultur heimisch waren und zum größten Theile erhalten
worden sind, wie die deutsche Schweiz, das Elsaß, die russischen
Ostseeprovinzen, Schleswig“, oder die „zwar in dem Bereiche einer
völlig fremden Nationalität liegen, aber doch als isolirte deutsche
Kulturpunkte zu betrachten sind, wie mehrere größere Städte Ungarns
und Polens.“ („Einleitung“ zum ersten Teile des „Codex Nundiarius
“, ebenda 1850, S. VI.); zum andern, daß in jenen Jahren
die Meßkataloge, welche Schwetschkes Quelle bilden, ausstaffiert
wurden „mit Flugblättern und Disputationen, Werkchen, die früher
selten oder nie darin aufgeführt wurden.“ (Johann Goldfriedrich,
„Geschichte des Deutschen Buchhandels“ Bd 4, Leipzig, Börsenverein
der Deutschen Buchhändler 1913, S. 13.)
S. 291, Z. 34 f.: p. 750. Anschütz spielt wie ein roher Bauer
[usw.]: Ebenda Nr 188. 21. September: Die S. 750 beginnt mit
Heinrich Adamis Besprechung einer Aufführung von „Minna von
Barnhelm“ im Hofburgtheater. Darin steht der Satz: „Franziska
und Paul Werner wurden von Mad. Anschütz und Hrn. Wilhelmi
mit vieler Laune, und der diesen Rollen zusagenden humoristischen
Lebhaftigkeit gegeben.“ — Heinrich Anschütz (1785 bis
1865) war nebst seiner Gattin seit dem Jahre 1821 Mitglied des
Hoftheaters in Wien. Grabbe hat Gelegenheit gehabt, das Ehepaar
auf der Bühne zu sehen, denn es hat in der Zeit vom 7. bis 25.
Juli 1822 in Berlin gastiert. Anschütz trat dabei auf als Don Gutierre
in Calderons Schauspiel „Der Arzt seiner Ehre“ (in der Bearbeitung
von West), als Hugo in Müllners „Schuld“, als Wallenstein
in „Wallensteins Tod“, als Marquis Posa, als Berger in Holbeins
Lustspiel „Der Verräther“ und als Sigismund in Calderons „Leben
ein Traum“. Seine Gattin aber gab die Julie in dem Lustspiel
„Beschämte Eifersicht“ von Johanna Franul von Weißenthurn, den
Ernst von Helm in dem Lustspiel „Die Liebeserklärung“ von Kurländer,
die Gurly in Kotzebues Lustspiel „Die Indianer in England“,
die Thekla in „Wallensteins Tod“, die Wilhelmine von Sachau in
Jüngers Lustspiel Die Entführung“, die Base in „Das war ich“,
ländliche Szene von Hutt, die Elise in Contessas Lustspiel „Das
[Bd. b6, S. 742]
Räthsel, das Klärchen in Holbeins „Verräther“ und das Suschen in
Claurens Schauspiel „Der Bräutigam aus Mexiko“.
S. 291, Z. 35—37: In Altona gelten Pandekten [usw.]: Ebenda:
Die erste Notiz im „Bunten aus der Zeit“ beginnt: „— In Altona
ist vor Kurzem das Gräßliche geschehen. Ein Brudermord ist verübt
worden! Der unglückliche Mörder soll erst 12 bis 13 Jahre alt seyn,
und ist daher, was weltliche Strafe betrifft, noch nicht zurechnungsfähig.
“ — Es verhält sich in der Tat so, daß im Jahre 1835
in dem (damals dänischen) Altona das gemeine (römische Pandekten
-)Recht die Grundlage des bürgerlichen Rechts gebildet hat. (Auskunft
des Herrn Dr. Harbeck, Senators in Altona.) Über die Grenze
der Zurechnungsfähigkeit befinden sich beide Parteien im Irrtum;
denn die Pandekten legen diese in kein bestimmtes Jahr. Es heißt
darüber in Bernhard Windscheids „Lehrbuch des Pandektenrechts“
Bd 1 (9. Aufl. bearb. von Theodor Kipp. Frankfurt a. M., Rütten
& Loening 1906), § 101, Ziffer 5: „Alle Schuld setzt voraus, daß
der Geisteszustand der betreffenden Personen es erlaubt, sie für die
Folgen ihres Wollens und Nichtwollens verantwortlich zu machen
(Zurechnungsfähigkeit). Die Zurechnungsfähigkeit wird namentlich
durch Wahnsinn11 und jugendliches Alter12, in gleicher Weise aber
auch durch vorübergehende Zustände von Geistesgestörtheit ausgeschlossen
13.“ Die Anmerkung 12 konstatiert ausdrücklich, daß
die Grenze hier keine juristisch bestimmte
sei, es vielmehr auf die geistige Ausbildung im einzelnen Falle
ankomme. Ausgegangen aber werde davon, daß nicht zurechnungsfähig
das Kind, zurechnungsfähig der pubertati proximus sei (nach
§ 54, Anm. 7 wird das zurückgelegte achtzehnte Jahr plena pubertas
genannt und geht der Ausdruck proximus pubertati nicht auf eine
bestimmte Altersstufe.) Was nun noch im besonderen Grabbes Festsetzung
anlangt, so liegt dabei fraglos eine Verwechslung der Zurechnungsfähigkeit
mit der Handlungsfähigkeit vor. Diese begann
nach dem römischen Rechte in der Tat mit dem siebenten Jahre,
allerdings erst mit dem vollendeten (Windscheid, a.a.O. § 71, Ziffer
3.) Vgl. dazu auch Christian Friedrich Glücks „Ausführliche Erläuterung
der Pandecten nach Hellfeld“, T. 2, 2. Aufl. (Erlangen,
Palm 1800), § 130 (S. 210 ff.). Zu Grabbes Glosse ist aber weiterhin
zu sagen, daß für einen Mord die Pandekten überhaupt nicht maßgebend
waren, da diese in der Hauptsache nur zivilrechtlicher, nicht
strafrechtlicher Natur sind und strafrechtliche Fragen darin nur
vorkommen, soweit daraus Ansprüche auf Schadenersatz entstehen
können. In Altona muß es also neben den Pandekten, wie in den
deutschen Staaten, noch ein besonderes Strafgesetzbuch gegeben haben,
und dies ist, nach der Auskunft des genannten Senators, die
Halsgerichtsordnung Karls V. (Constitutio Criminalis Carolina) gewesen.
In dieser aber wird die Frage, wann Minderjährige unzurechnungsfähig
seien, nur ganz im allgemeinen, und zwar im Artikel
179, folgendermaßen beantwortet: „Item wurt von jemandt, der,
Jugent oder anderer geprechlicheit halbenn, wissentlich seiner synne
nit hett, ein vbellthat begangen: Das soll mit allen vmbstennden
an die orte vnd enden, wie zu ende diser vnser ordnung angezeigt,
gelangen vnnd nach Rathe derselben vnd anderer verstendigen darjnne
[Bd. b6, S. 743]
gehandellt oder gestrafft werden.“ (Kritische Ausgabe von
J.[oseph] Kohler u. Willy Scheel. Halle a. S., Buchhandlung des
Waisenhauses 1900. S. 95.) Eingehendere Bestimmungen finden sich,
besonders in Artikel 164, nur für Diebe.
S. 291, Z. 37 — S. 292, Z. 4: p. 751. Die Tulpen! Daß das
Schweinezeug [usw.]: Ebenda steht auf S. 751, unter derselben
Rubrik, die folgende Meldung:
„— Eine neue Tulpe, welcher die Societät der Blumisten zu Gent
den Namen der Citadelle von Antwerpen gegeben hat, ist unlängst
von Hrn. Vanderninck, einem Blumenfreunde in Amsterdam,
für die Bagatellsumme von 16,000 Francs gekauft worden. So gab
in frühern Zeiten ein Particulier in Lille für eine ähnliche seltene
Tulpe ein ganzes wohleingerichtetes Brauhaus, seit welcher Zeit das
Brauhaus mit der Tulpe den Namen vertauschte, und diese das
Brauhaus, jenes die Tulpe hieß. Und so beweisen auch die Tulpen
ihrerseits, daß die Narren in der Welt nicht aussterben.“
cambium bedeutet Wechsel. Was aber Grabbe mit Wechselzeichen
meint, welche Einrichtung oder welchen Vorgang der Handelswelt
er überhaupt im Auge hat, ist um so weniger zu sagen möglich,
als das Wort nirgends belegt ist. Sicher ist, daß Grabbe glaubt,
das Wort Tulpe werde hier in übertragener Bedeutung von einem
kaufmännischen Zahlungsmittel gebraucht.
In betracht kommt folgende Literatur. Über die „Tulpenmanie in
den Niederlanden“ handelt Max Wirth in seiner „Geschichte der
Hanselskrisen“ (3., verm. u. verb. Aufl., Frankfurt am Main, Sauerländer
1883), S. 23—26. Eine eingehende Darstellung des Tulpenschwindels
auf Grund einer Fülle von zeitgenössischen Quellen gibt
der Graf H. zu Solms-Laubach, Professor der Botanik an der Universität
Strassburg i. E., in seinem Werke „Weizen und Tulpe und
deren Geschichte“ (Leipzig, Felix 1899) auf den S. 76—94. Endlich
wird vornehmlich die rechtliche Seite der Ereignisse von Rudolf
Stammler gedeutet im ersten Bande seines Buches „Deutsches Rechtsleben
in alter und neuer Zeit“ (Charlottenburg, Pan-Verlag Rolf
Heise 1928), S. 211—22 (im fünfzehnten Kapitel: Die Harlemer
Tulpenmanie. 1634 bis 1637). Grabbes Ansicht, daß die Tulpen lediglich
Wechselzeichen, oder Namen für Wechsel, gewesen seien,
findet in keiner dieser Darstellungen eine Stütze. Dasselbe gilt von
seinem Zweifel an den für Tulpenzwiebeln gezahlten Preisen. Daß
diese in der Tat eine schwindelhafte Höhe erreicht haben, und für
das Jahr 1637 urkundlich beglaubigt sind, ist festgestellt und in
volkswirtschaftlichen Betrachtungen der Nachwelt aufbewahrt worden.
(Stammler, a.a.O. S. 214.) Recht hat er lediglich insofern, als
der Handel mit Tulpenzwiebeln nicht durchweg einen unreellen Charakter
gehabt haben wird. Vielmehr bezeichnen, nach Ansicht des
Grafen zu Solms-Laubach, Windhandel und Blumenbörse „nur das
Endstadium eines von langer Hand vorbereiteten Processes. Reelle
Händel werden, so lange wirkliche Liebhaber vorhanden waren, stets
nebenher gegangen sein, denn solchen Liebhabern konnte es nur
um die Blumen, nicht um Geldspeculationen zu thun sein, gehörten
sie doch den höchsten Schichten der holländischen Gesellschaft an,
so dass man sie gewiss nicht in den Kneipen zu suchen hat, wo
[Bd. b6, S. 744]
zuletzt die Comparitien tagten.“ (A.a.O. S. 87—88.) Endlich ist
auch daran etwas Wahres, daß, wie Grabbe schreibt, jede gehandelte
Tulpenzwiebelart die Bedeutung einer Geldsumme gehabt
habe, aber darum nicht selbst für solche verkauft oder versendet
worden sei. Denn das Ganze hatte, nach Stammler, den Charakter
eines Kettenhandels. „Die Ware befand sich überhaupt nicht in der
Hand des Verkäufers, und er hatte auch gar keine Aussicht noch
Möglichkeit, sie in Natur zu erhalten. Die oft verhandelte Spezies
Semper Augustus war, wie es heißt, überhaupt nur in zwei Exemplaren
vorhanden, von denen das eine in Amsterdam, das andere
in Harlem lag. Der Kauf und Verkauf wurde also nur auf dem
Papier abgeschlossen und an dem bestimmten Lieferungstage in der
Weise ausgeführt, daß lediglich die Differenz zwischen dem verabredeten
und dem jetzt gegebenen Preise zu leisten war.“ (A.a.O.
S. 215.) Es war also eine Vertragsweise, die man späterhin als das
reine Differenzgeschäft bezeichnete. (A.a.O. S. 220.)
Bei der zeitlichen Abgrenzung des Tulpenschwindels gehen die
Meinungen auseinander. Während Wirth und Stammler den Beginn
in das Jahr 1634 legen (Wirth, a.a.O. S. 24), nimmt der Graf zu
Soms-Laubach 1636 als Anfangsjahr an (A.a.O. S. 93). Übereinstimmung
herrscht darin, daß die Katastrophe ziemlich unvermittelt
im Februar 1637 eingetreten ist.
S. 292, Z. 5—7: p. 754. Kennen Referent und der Chemiker aus
Dublin [usw.]: Ebenda Nr 189. 22. September: Auf S. 754 steht
unter der Rubrik „Weltpanorama“ folgende Mitteilung aus Dublin:
„Ein Chemiker zu Dublin hat nach allerlei kostspieligen Versuchen
eine flüssige Composition erfunden, welche die Eigenschaft besitzt,
alle porösen weichen Körper binnen wenigen Monaten in eine quarzartige
Steinmasse zu verwandeln. Die Gegenstände aus der Pflanzenoder
Thierwelt werden nämlich in die Flüssigkeit hineingelegt, und
entgehen von dem Augenblicke an dem Zustande der Verwesung.
Auf diese Weise lassen sich nun Menschen und alle Gattungen Thiere,
welche in Spiritus aufbewahrt zu werden verdienen, in Steinbilder
metaphorphosiren, und sind in dieser Gestaltung geeignet, ihre Umrisse
bis in die spätesten Zeiten hinüber zu tragen. Wäre diese Kunst
schon in den Zeiten der Griechen und Römer bekannt geworden, so
könnten wir vielleicht die berühmten Heroen und Dichter der Vorwelt
auch noch körperlich in Augenschein nehmen, da gegenwärtig
nur ihre fragmentarischen Geistesproducte als Vermächtniß auf die
Mitwelt gekommen sind.“
S. 292, Z. 7 f.: 756. Druckfehler oder Dummheit [usw.]: Ebenda
S. 756: Eine Notiz im „Bunten aus der Zeit“ berichtet von einem
Felssturze vom Hauptgipfel des „Deut dü Midi“. Daß es sich dabei
um einen Druckfehler handelt, dürfte außer Frage stehen.
S. 292, Z. 8 f.: Hr. Wild sollt's Maul halten [usw.]: Ebenda Nr
190. 23. September. S. 759: In einem Theaterbriefe „Aus Prag“
berichtet Falkland über das dortige Auftreten [Franz] Wilds als
Zampa [in Hérolds gleichnamiger Oper]. Der Referent stellt fest,
daß Wild nicht mehr imstande gewesen sei, den hohen Erwartungen
des Publikums zu genügen; daß sich im Ganzen nicht jene Begeisterung
gezeigt habe, mit der man ihm einst zugejauchzt hatte, und
[Bd. b6, S. 745]
in dem nicht sehr vollstimmigen Beifall sich mehr besonnene Anerkennung,
als glühendes Entzücken ausgesprochen habe. Als Grund
dafür konstatiert der Referent: „Die hohen Brusttöne — [...] —
sind, ihres langen Dienstes müde, Hrn. Wild abtrünnig geworden,
der Tenor ist in seinen zarteren Bestandtheilen verwittert, und Hr.
Wild hat nur noch über einen wunderschönen Bariton zu gebieten,
der aber Tenordienste verrichten, und daher das Nöthige vom Falsett
sich borgen muß, das Falsett hat aber viel von einem Wucherer:
indem es nur zinnvermengte mattklingende Münze auszahlt, streicht
es immer mehr von dem reinen lautern Silber der Bruststimme als
Zinsen ein; übrigens gibt auch die Zusammenleimung von Brustund
Falsetttönen dem Gesange den widrigen Charakter der Zerstücktheit,
den nur ein Meister wie Hr. Wild durch seine übrigen
reichen Vorzüge mildernd zu überkleiden vermag.“
S. 292, Z. 10—19: Freimüthige. Hr. Alexis quälen sich
[usw.]: „Der Freimüthige“ Nr 185—86. 17. u. 18 .September. „Hannibal,
von Grabbe.“ Die anonyme Besprechung ist in Bd 4 von
„Grabbes Werken in der zeitgenössischen Kritik“ (Detmold 1963),
S. 9—15 in ihrem Wortlaute wiedergegeben.
Immermanns „Trauerspiel in Tyrol“, zuerst 1828 veröffentlicht,
ist 1835 im dritten Bande der „Schriften“ (Düsseldorf, Schaub,
S. 245—434) unter dem Titel „Andreas Hofer der Sandwirth von
Passeyer. Ein Trauerspiel“ in stark veränderter Gestalt erneut herausgekommen.
Die Ansicht, daß der Dichter zu der Umwandlung
mehrerer Stellen in Prosa (vgl. den Beginn des ersten Aufzuges,
den dritten, Anfang und Ende des vierten und den Beginn des
fünften) unter anderem durch Grabbes 1831 gedruckten „Napoleon“
angeregt worden sei, ist vielleicht nicht völlig von der Hand zu
weisen, zumal Immermann dieses, von ihm sehr geschätzte Drama
in der „Vorrede“ zum ersten Bande der „Schriften“ (S. VI) ausdrücklich
aus den, mit seinem „Hofer“ auf gleicher Stufe stehenden
Versuchen, noch lebende oder jüngst verstorbne Personen in poetische
zu verwandeln“, hervorhebt als ein Werk, in dem diese Kühnheit
„auf eine glückliche und wahrhaft genialische Weise“ geübt sei.
Geäußert wird diese Ansicht freilich weder von den zeitgenössischen
Kritikern der Umarbeitung, noch von den Herausgebern der Werke
Immermanns noch endlich von dessen Biographen Harry Maync, was
aber vielleicht damit zusammenhängt, daß eine besondere literarhistorische
Vergleichung der beiden Fassungen noch aussteht. — Auf
die von Grabbe berührte Frage, ob und in welchem Umfange er
die zeitgenössische dramatische Produktion der Franzosen beeinflußt
habe, kann noch keine Antwort erteilt werden, da sie auf völlig
unbearbeitetes Gelände führt. Daß aber auch anderen der Gedanke
kommen konnte, Victor Hugo zu Grabbes „Gothland“ in Beziehung
zu setzen, mag eine Notiz über „Französische und Englische Literatur
“ in dem von Ferdinand Philippi herausgegebenen „Literarischen
Hochwächter“, einer „Literatur- und Conversations-Zeitung für die
Gebildeten im deutschen Volke“ beweisen. Sie findet sich in der
Nr 33 vom 13. September 1833 auf S. 131—32; ihr erster Teil
lautet folgendermaßen:
„»Die jetzige französische poetische Revolution — heißt es
[Bd. b6, S. 746]
irgendwo — läßt sich füglich mit der alten politischen Revolution
vergleichen; der Kunststaat, scheint es, soll die nämlichen
Stadien durchlaufen, wie der wirkliche. Die jungen französischen
Dichter sind die Terroristen und poetischen Schreckensmänner;
sie dürsten nach Blut, sie schnauben nach Mord; ringshin Verwüstung
und Elend zu tragen ist ihre Lust, Henker und Folterknechte sind
ihr Hofstaat, aus Schandthaten ihre königl. Gastmahle bereitet, und
ihr Ruhebett ist Verzweiflung. Es ist, wie dort, ein totaler poetischer
Wahnsinn, von dem die ganze Schule ergriffen ist, aber ein
Wahnsinn der, wie dort und wie vielleicht jede Verrücktheit, aus
moralischer Quelle fließt; aus der Losreißung von jedem
religiösen Element, aus Sittenlosigkeit und Hochmuth. — Das
Ziel dieser Bahn ist poetischer und moralischer Untergang zugleich.
Das fühlt man selbst in dem leichtsinnigen, zerworfenen
Frankreich mehr und mehr, und von Tag zu Tag erhebt sich lauter,
entschiedener, die Stimme der tiefsten Indignation über dies
wüste, gottverlassene Treiben. Man sehe nur Victor Hugo's
dramat. Werke durch. In seinem »Cromwell haben wir es mit lauter
Narren zu thun; der Held in »Hernani ist ein Räuber, die
Heldin von »Maria Delorme eine öffentliche Dirne; die Hauptrolle
von »le roi s'amuse spielt ein gemeiner Hofkuppler, und in
»Lucretia Borgia soll eine ehebrecherische und blutschänderische
Giftmischerin unser Mitgefühl in Anspruch nehmen! —
Die »Revue théatrale et sans annonces payées also eine Gegnerin
der romant. Schule in Frankreich berichtet daher über ein
neues Stück von Victor Hugo folgendermaßen:
»Herr V. Hugo arbeitet, wie man sagt, an einem Schwank in
5 Acten, in welchem nur eine einzige kleine Nothzucht, zwei
Blutschändungen, ein Ehebruch, drei Todtenträger
und ein Leichenwagen vorkommen. Die Hauptacteurs
werden auf dem Kopfe gehen. Der 2te Act wird auf
dem Seile getanzt, ohne Balançirstange. Zum Schluß eine Leichenöffnung,
bei welcher Psalter auf die Melodie von Marlborough
gesungen werden. Das klingt freilich gräßlich und
kann füglich als Pendant zum »Herzog Theodor von Gothland
des talentvollen Grabbe dienen. Jene kurze Kritik des
Hugoschen Embryo ist indeß ein wirkliches Recept für das
ganze Genre der Producte neuerer französischer Romantiker. Herbei
ihr deutschen Tragöden, hier ist Wasser für eure Mühlen!“ —
Zu Grabbes Urteil über die „neuere französische Schule“ vergleiche
man noch seine Kritik von Victor Hugos „Maria Tudor“ in Nr 362
des „Düsseldorfer Fremdenblattes“ vom 28. Dezember 1835. (Bd 4,
S. 174—176.)
S. 292, Z. 21—23: Steffens und Herder [usw.]: Ebenda Nr
187—89. 19.—22. September: „Steffens. [Unterz.:] Timm.“ Darin
heißt es auf der zweiten Seite (750): „Steffens hat viel Aehnliches
mit Herder. Auch dieser Mann, wohin er mit der Fackel seines
Geistes leuchtete, verbreitete Erkenntniß des Wahren; aber auch
er konnte Andern keine allgemeine Zufriedenheit abgewinnen, weil
er, mit sich selber uneins, sich nie zu einer reinen, heitern, objectiven
Höhe hinaufschwingen konnte. Wenn indessen eine gewisse herbe
[Bd. b6, S. 747]
Bitterkeit, welche Herder aus der Unverhältnißmäßigkeit seiner
Bestrebungen sog, für den Betrachtenden etwas schmerzlich Peinigendes
hat, so hat Steffen's Geist, trotz aller innerlichen und äußerlichen
Kämpfe, neben einem trüben Elemente eine versöhnende Kindlichkeit
des Geistes behalten.“ —
Henrich Steffens war am 2. Mai 1773 zu Stavanger geboren und
seit 1832 Professor an der Berliner Universität, wo er Vorlesungen
über Naturphilosophie, Anthropologie und Religionsphilosophie
hielt. Mineraloge von Haus aus, wurde er anfangs von der Lehre
Spinozas, später von der Probevorlesung Schellings mächtig angeregt,
„worin die Idee einer Naturphilosophie und die Nothwendigkeit,
die Natur aus ihrer Einheit zu erfassen, energisch auseinandergesetzt
wurde“. (O. Liebmann, ADB Bd 35, S. 556.) Auf solcher
Grundlage erwuchs eine geschichtliche Ansicht von der Natur und
das Bemühn, „Entstehung und Geschichte des Menschen einzureihen
in einen Zusammenhang mit dem Erdorganismus und der Entwicklung
des ganzen Sonnensystems“. In der ganzen organischen Entwicklung
komme es namentlich auf die Individualität an, die erst
im Menschen ganz erfüllt sei. (Friedrich Ueberwegs „Grundriß der
Geschichte der Philosophie“ T. 4. 11. Aufl. Berlin, Mittler 1916.
S. 57.) So stellte Steffens in den 1801 erschienenen „Beiträgen zur
inneren Naturgeschichte der Erde“, seiner ersten und in mancher
Beziehung genialsten Schrift, „die Idee einer »geologischen Entwicklungsgeschichte
des Planeten auf, vermöge deren dieser sich in
allmählicher Umbildung zum Träger des organischen Lebens gestaltet
und zu dessen immer höherer Ausbildung befähigt habe“. (Wilhelm
Windelband, „Die Geschichte der Neueren Philosophie in ihrem
Zusammenhange mit der allgemeinen Kultur und den besonderen
Wissenschaften“, Bd 2, 5., durchges. Aufl., Leipzig, Breitkopf &
Härtel 1911, S. 260.) In späteren Jahren nahm er dann in seiner
„Anthropologie“ (2 Bde. 1822) den feststehenden Gedanken seiner
Naturphilosophie wieder auf. Der Mensch soll darin „als lebendige
Einheit des Geistes und der Natur, somit als mikrokosmischer Vertreter
des Universums begriffen werden“. Ganz im schellingschen
Sinne werden Physik, Geologie und Physiologie herbeigezogen, „um
mit phantastischem Analogienspiel und willkürlicher Symbolik die
teleologische Weltentwicklung von den anorganischen Naturfactoren
an bis zu dem in freier Sittlichkeit und religiösem Bewußtsein sich
entfaltenden Typus des Menschenthums vor Augen zu führen. Daß
diese phantastische Anthropologie neben lautem Beifall auch heftige
Angriffe erfuhr, ist kein Wunder.“ (Liebmann, a.a.O. S. 557.) Daneben
entwickelte Steffens eine christlich gefärbte Religionsphilosophie,
und endlich gab er auch seiner poetischen Naturanlage Spielraum,
„und zwar in einer Richtung, die durch sein religiöses Innenleben
wesentlich mitbestimmt war. Er schrieb eine längere Reihe
von Novellen, wie 'die Familie Walseth und Leith' (3 Bde, 1827)
und 'Die vier Norweger' (6 Bde, 1828); Dichtungen, die vielen Beifall
fanden und in denen die Schilderung großer nordischer Naturscenerien
sich mit feiner psychologischer Beobachtung und dem
Grundton einer tief empfundenen Religiosität auf eigenthümliche
Weise verschwisterten“. (Liebmann, a.a.O. S. 558.)
[Bd. b6, S. 748]
S. 292, Z. 23—25: p. 754. Hoffmann von Fallersleben [usw.]:
Ebenda Nr 188. 21. September. S. 754:
Was mir bleibt.
Herz, was blieb dir für dein übrig Leben?
Blieb dir mehr, als Gram und Leid?
Alles Schöne hast du weggegeben,
Deine Lust und Fröhlichkeit.
Aber dennoch kannst du nicht verarmen,
Dennoch bleibst du reich und jung:
Gott will deiner sich ja stets erbarmen,
Gott giebt die Erinnerung.
Hoffmann von Fallersleben.
(Mit dem Zusatze: „Juli 1830“ in dessen „Gesammelten Werken“,
hrsg. von Heinrich Gerstenberg. Bd 1. Berlin, Fontane 1890. S. 22.)