| Nr. 636, siehe GAA, Bd. VI, S. 265 | 17. Juli 1835 |  | | Christian Dietrich Grabbe (Düsseldorf) an Carl Georg Schreiner (Düsseldorf) | | Brief | | | | Vorangehend:  | Nachfolgend:  |
| 5 Die verfluchten Journale. Die Modezeitung fängt ahnungsvoll an, mit Miserrimus (a). Daß so niederträchtiges Zeug wie Leislers Curtius, p. 365 gedruckt wird, ist unter Eseln sehr begreiflich. Modezeitungchen, magst auch Disteln? 10 p. 366. Thorwaldsen (si historia vera) ein Narr. Wer gibt sich zu erkennen, ohne daß er muß? Erkennen und bekennen sind Nachbarn. — p. 366 u. 67. Da wird von Francia geschwatzt als lebte er noch. Was man nicht alles erlebt, selbst Todtes. — Die Moden u. Kupfer schändlich schlecht. — Sir 15Arkwright seyn ein eitler Narr und haben sehr steif in einer baumwollnen Weste einem Pinsel gesessen. — Intelligenzbl. nr. 23 wird Mondats Syrup gegen die Unfruchtbarkeit empfohlen. Teufel, ein Syrup gegen die Fruchtbarkeit ginge besser ab. — p. 380 verdreifacht Octavio May sein Vermögen, 20nachdem er vorher nichts gehabt! Also ward er 3fach ärmer. — Hat Cafarelli so gelernt, so begreift man, wie die Dummen ihn bewundern, Leute von Verstand und Gefühl vor seinen Arien, besonders werden sie eingelegt, weglaufen. — Richard Roos! Kannst du's nicht durch Dichtung verschönern, brauchst 25du's nicht zu besingen. Mäuse, auf Speck, schweigen doch. Das Wagenf.[est] zu Dschagern.[at] kennt man seit 60 Jahren. Das Bildermagazin mahlts ab. Bequem. — Marie Antoinette war grau, wie sie zur Guillotine fuhr. Die hatte ihre letzten Jahre nach Minuten gezählt. — Dummeres Zeug wie el. Welt 30nr. 107: „an die geneigten Leser“, las ich noch nicht. „Mich in Kurzem verständigen zu wollen, hieße mir selbst vorgreifen “. Ja, Redacteur Kühne, du hast viel vorzugreifen, ehe du Verstand bekommst. Die verfluchten Journale. Die Modezeitung fängt ahnungsvoll an, mit Miserrimus (a). Daß so niederträchtiges Zeug wie Leislers Curtius, p. 365 gedruckt wird, ist unter Eseln sehr begreiflich. Modezeitungchen, magst auch Disteln? 10 p. 366. Thorwaldsen (si historia vera) ein Narr. Wer gibt sich zu erkennen, ohne daß er muß? Erkennen und bekennen sind Nachbarn. — p. 366 u. 67. Da wird von Francia geschwatzt als lebte er noch. Was man nicht alles erlebt, selbst Todtes. — Die Moden u. Kupfer schändlich schlecht. — Sir 15Arkwright seyn ein eitler Narr und haben sehr steif in einer baumwollnen Weste einem Pinsel gesessen. — Intelligenzbl. nr. 23 wird Mondats Syrup gegen die Unfruchtbarkeit empfohlen. Teufel, ein Syrup gegen die Fruchtbarkeit ginge besser ab. — p. 380 verdreifacht Octavio May sein Vermögen, 20nachdem er vorher nichts gehabt! Also ward er 3fach ärmer. — Hat Cafarelli so gelernt, so begreift man, wie die Dummen ihn bewundern, Leute von Verstand und Gefühl vor seinen Arien, besonders werden sie eingelegt, weglaufen. — Richard Roos! Kannst du's nicht durch Dichtung verschönern, brauchst 25du's nicht zu besingen. Mäuse, auf Speck, schweigen doch. Das Wagenf.[est] zu Dschagern.[at] kennt man seit 60 Jahren. Das Bildermagazin mahlts ab. Bequem. — Marie Antoinette war grau, wie sie zur Guillotine fuhr. Die hatte ihre letzten Jahre nach Minuten gezählt. — Dummeres Zeug wie el. Welt 30nr. 107: „an die geneigten Leser“, las ich noch nicht. „Mich in Kurzem verständigen zu wollen, hieße mir selbst vorgreifen “. Ja, Redacteur Kühne, du hast viel vorzugreifen, ehe du Verstand bekommst.  — — — — Daß der letzte Kaiser todt ist! — — — — 35 p. 432. Theodor Maul über Talleyrand! Schluckt und verdaut und scheißt ihn nicht. nr. 109. Ei, ei, Hr. Koenig, merken wir, warum Elegantchen dich so lobte. Hohe Braut! eppes höchter wäre gut. — — — — Daß der letzte Kaiser todt ist! — — — — 35 p. 432. Theodor Maul über Talleyrand! Schluckt und verdaut und scheißt ihn nicht. nr. 109. Ei, ei, Hr. Koenig, merken wir, warum Elegantchen dich so lobte. Hohe Braut! eppes höchter wäre gut. [GAA, Bd. VI, S. 266] Machen Sie nur, daß unsere Sachen überall angezeigt werden und diese Lumpen naß machen. p. 458. Ochs. Napoleon hatt' 'ne kurze Stirn. Kämmte auch das Haar darüber. 5 Ueber die Eisenbahnen wird soviel Papier verschmiert, daß ich rathe, aus letzterem Papierbahnen zu machen. Freimüthiger: Hutten war venerisch. Ph. v. Leitner mag seine Shyloksexposition selbst lesen. — Morier ist ein trockner Kerl, und deshalb Windbeutel. Die Sorte kennt man lange, 10aber unsere Ochsen! Was die lernen und lehren! Griepenkerls Uebers. des Sopphokl. ist sicher gut! Er ist ein tüchtiger Niedersachse u bückt sich vor keinem oberen. — Aus „dem Reisejournal eines Zukünftigen“ sollte man schmieren. Mad. Birch-Pfeiffer bezahlt, oder läßt sich viel machen, damit man 15ihre Federkinder lobt. — Nach allem, was ich lese, ist Seydelmann doch nur berechnendes Talent, kein Genie, schaffend, am Ocean und an Erdentiefen sitzend. Ziegen. Die Minerva wird von Monat zu Monat schlechter. All das Zeugs, was sie enthält, kennt man. Gestohlen aus Eichhorn 20d. J. — Rhapsod. Bemerk. über Staatsdienst. Dumm. Alle Lebensregeln beruhen darin: stelle Du dich so, daß Du heiter existiren kannst, und Andere auch. — Miscellen — hätt' ich Forellen!  Im Ausland nr. 154 seyn wir auch von den Franzosen 25erwähnt. Na, nützt der „Grabbe“ nur. Ich bin gar vorangestellt. Teufel. Stets und ewig was man weiß in dem Zeug. Ich hoffe heute mit Zandyck fertig zu werden. Die verfluchten Journale halten auf. 30 Düss. 17 Aug. [richtig: Juli(?)] 1835. Sepulcrum + b. Bediente. (zitternd:) Mein Herr! — — 35 Landgraf. Dir ist? Bd. Ein Maler! Gott sey mir Sünder gnädig, daß ich ihn sah! Im Ausland nr. 154 seyn wir auch von den Franzosen 25erwähnt. Na, nützt der „Grabbe“ nur. Ich bin gar vorangestellt. Teufel. Stets und ewig was man weiß in dem Zeug. Ich hoffe heute mit Zandyck fertig zu werden. Die verfluchten Journale halten auf. 30 Düss. 17 Aug. [richtig: Juli(?)] 1835. Sepulcrum + b. Bediente. (zitternd:) Mein Herr! — — 35 Landgraf. Dir ist? Bd. Ein Maler! Gott sey mir Sünder gnädig, daß ich ihn sah! [GAA, Bd. VI, S. 267] Ich will zwölf Messen lesen lassen! So'n Eulenthier! Gott, o Gott! Er mahlt Madonnen, und steht vor der Thür! doch das Rechte. 5Grabbe. [Adresse:]  Dem Herrn Buchhändler Schreiner Wohlgeboren. Anbei eine Mappe mit 6 Journalen. Dem Herrn Buchhändler Schreiner Wohlgeboren. Anbei eine Mappe mit 6 Journalen. |
| |


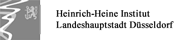


636.
H: Doppelbl. in gr.-20; 3 S., Adresse auf S. 4.
F: GrA
T: Bd 4, S. 343, Z. 24—31.
S. 265, Z. 31 f.: vorgreifen“.] vorgreifen“ H
S. 266, Z. 3: hatt'] hatt H
S. 265, Z. 6: Die Modezeitung fängt ahnungsvoll an [usw.]: „Moden
-Zeitung“ Nr 21—27: „Miserrimus. Novelle.“ Es ist die Beichte
eines Mannes, der, von Haß und Rachsucht getrieben, das Weib mordet,
mit dem er durch wechselseitige Liebe verbunden ist. — Miserrimus
bedeutet: Der Elendeste, Unglücklichste, Bejammernswerteste.
S. 265, Z. 7—9: Daß so niederträchtiges Zeug [usw.]: Ebenda Nr
23. Sp. 365: „Curtius.5*) ([Dazu die Anmerkung:]
[Bd. b6, S. 631]
5*) Aus Georg Leislers kleiner Gedichtesammlung [„Gedichte für Teutsche
“] (Darmstadt bei Heil [1835] abgedruckt, die einiges recht artige
enthält.)“
Das Gedicht lautet:
Zu Rom auf dem Markt, wie die Sage es spricht,
Eröffnet sich plötzlich der Grund:
Verheerend, mit giftigen Dämpfen, bricht
Das Fieber aus finsterem Schlund,
Schwebt über die Stadt hin und eilet, voll Graus,
Todbringend, verpestend, von Haus zu Haus.
Vergebens steigt Opferrauch auf dem Altar
Der Götter zum Himmel hinan,
Vergebens strengt rastlos die trauernde Schaar
Des römischen Volkes sich an,
Den Abgrund zu füllen, bekümmert und bleich:
Es bleibt sich doch immer der gähnende gleich.
„Denn“ sprach das Orakel, „erst dann wird bedeckt
Mit jenem die feindliche Macht,
Die drohend euch, zitternde Bürger, erschreckt,
Gewöhnliche Opfer verlacht,
Wenn Einer, was Jeder am meisten sonst liebt,
Freiwillig, als köstliche Sühne, hingiebt!“
Und freudig erschienen mit Hab und Gut
Die Römer und warfen hinein
Das Theuerste all' in die Höllengluth —
Die Weiber ihr Edelgestein:
Doch war es vergeblich, mit dumpfem Klang
Jed' Opfer die gierige Tiefe verschlang. —
Da stürmte zu Rosse mit feurigem Blick
Ein edler Patrizier herbei,
Kühn wirft er den staunenden Pöbel zurück:
„Quiriten, ich mache euch frei!“
So rief er und stürzt sich hinein mit dem Roß,
Und donnernd der Abgrund sich über ihm schloß.
S. 265, Z. 10—12: p. 366. Thorwaldsen (si historia vera) [usw.]:
Ebenda Sp. 366 lautet eine der Miscellen:
„(Thorwaldsen.) Als Thorwaldsen einst nach Stuttgart
fuhr, holte er einen jungen Mann ein, der einen schweren Tornister
trug und den Kutscher bat, er möge ihn doch mitfahren lassen.
Thorwandsen hörte, daß der Kutscher die Bitte abschlug und lud
den Reisenden ein, zu ihm in den Wagen hineinzukommen. Sie
kamen bald in ein Gespräch, worin dann der Fremde erzählte, er
sey ein Maler, habe gehört, Thorwaldsen werde in kurzem in Stuttgart
erwartet, und sey deshalb sogleich aufgebrochen, um den
Künstler zu sehen, dessen Werke so großes Aufsehen in Europa
machen. 'Kennen Sie,' fuhr er fort, 'da Sie Rom erst vor kurzem
[Bd. b6, S. 632]
verlassen haben, Thorwaldsen vielleicht persönlich?' — 'Ja,' entgegnete
der Bildhauer, 'ich bin sein bester Freund und verspreche
Ihnen, Sie ihm in Stuttgart vorzustellen.' Der Maler war über
dieses Versprechen außer sich vor Freude, so daß der alte gutmüthige
Thorwaldsen sein Incognito nicht länger bewahren konnte, sondern
gestand, daß er selbst der sey, um dessen willen der junge Maler
weit gepilgert war.“
S. 265, Z. 10: si historia vera: wenn die Geschichte wahr ist.
S. 265, Z. 12—14: p. 366 u. 67. Da wird von Francia geschwatzt
[usw.]: Ebenda Sp. 366—67, gleichfalls unter den „Miscellen“:
„(Francia in Paraguay.) Wenn der Dictator von Paraguay
ausreitet, so schickt er gewöhnlich zwei Soldaten von seiner
Leibwache ein paar hundert Schritt voraus, und die Einwohner der
Stadt Paraguay wissen schon, daß, wenn diese Soldaten vor ihre
Häuser kommen, sie die Thüren derselben entweder ganz schließen
oder ganz aufmachen müssen; im letztern Falle muß der Besitzer
des Hauses heraus auf die Straße treten. Durch diese Vorsichtsmaßregel
will der Tyrann wahrscheinlich verhüten, daß man nicht
hinter einer angelehnten Thüre versteckt auf ihn ziele und schieße;
es ist aber auch möglich, daß er dadurch den Leuten zeigen will,
wie er, der Dictator Francia, der unumschränkte Herr und Gebieter
sey.“ — Grabbe ist im Irrtum: José Gaspar Rodriguez da
Francia, 1814 zum Diktator von Paraguay auf Lebenszeit ernannt,
ist erst am 20. September 1840 gestorben.
S. 265, Z. 14—16: Sir Arkwright seyn ein eitler Narr [usw.]:
Ebenda Nr 23. Sp. 362—64: „Galerie berühmter Männer. II. Sir
Richard Arkwright.5*) ([Dazu die Anmerkung:] 5*)Siehe Doppelkupfer
No 23.)“ — Arkwright, geboren als Sohn armer Eltern am 23. Dezember
1732 zu Preston in Lancashire, ist durch seine Vervollkommnung
der Baumwollspinnmaschine, durch die er einen neuen Industriezweig
gründete, zu Ansehen und Reichtum gelangt.
S. 265, Z. 16—19: Intelligenzbl. nr. 23 wird Mondats Syrup
[usw.]: Dieser „Sirop pour les époux sans enfants“ wird von einem
Dr. F. Laumann auch in der Nr 34 der „Zeitung für die elegante
Welt“ vom 16. Februar 1835, S. 136, angezeigt und in einem
Nachwort der Redaktion sehr empfohlen.
S. 265, Z. 19 f.: p. 380 verdreifacht Octavio May sein Vermögen
[usw.]: Ebenda Nr 24. Sp. 380, steht u. a. folgende Miscelle:
„(Eine Erfindung im 17. Jahrhunderte.) Der
Zufall hat die meisten Entdeckungen herbeigeführt. Hier einen neuen
Beweis. Einer der zahlreichen Fremden, welche im 17. Jahrhunderte
aus Italien die Seidenindustrie nach Lyon verpflanzten, Octavio
May, hatte sein Vermögen von mehrern Millionen in falschen Speculationen
versinken sehen. Eines Tages ging er am Ufer der Saone
hin, sann auf Mittel, diesen großen Verlust wieder gut zu machen,
und zerkauete in der Verzweiflung einige Seidenfaden. Dies gab der
Seide einen ungewöhnlichen Glanz. Octavio May bemerkte es, und
ersann sogleich die Anwendung eines mechanischen Verfahrens, welches
der Seide den Glanz gab, den wir nun an ihr kennen. Diese
Entdeckung rettete ihn von der Verzweiflung eines Bankerotts und
verdreifachte sein Vermögen.“
[Bd. b6, S. 633]
S. 265, Z. 21—23: Hat Cafarelli so gelernt [usw.]: Ebenda Sp.
380—81: Die folgende Miscelle lautet:
„(Der Gesanglehrer.) Porpora, einer der ausgezeichnetsten
maestros Italiens, faßte Freundschaft zu einem jungen Manne,
seinem Schüler und fragte ihn, ob er den Muth fühle, fortwährend
dem Wege zu folgen, den er ihm vorzeichnen wolle, wie langweilig
er ihm auch vorkommen möge. Auf die bejahende Antwort schrieb
er auf ein Blatt Papier die diatonische und chromatische Tonleiter,
auf- und absteigend, die Sprünge in Tertien, Quarten, Quinten etc.
Triller etc.
Dieses Blatt allein beschäftigte den Lehrer und Schüler ein ganzes
Jahr lang. Der Schüler fing an, unzufrieden zu werden, aber
der Lehrer erinnerte ihn an sein Versprechen. Das vierte Jahr verging,
es folgte das fünfte, und noch immer nichts als das ewige Blatt.
Auch im sechsten wurde es noch nicht aufgegeben, aber mit der Aussprache
und endlich der Declamation in Verbindung gebraucht. Am
Ende dieses Jahres erstaunte der Schüler gar sehr, der noch immer
bei den Anfangsgründen zu seyn glaubte, als ihm der Lehrer sagte:
'nun gehe, mein Sohn; Du hast nichts mehr zu lernen; Du bist der
erste Sänger Italiens und der Welt.' Und er hatte Recht, denn der
Sänger war — Cafarelli.“ — Caffarelli, eigentlich Gaetano
Majorano (1703—1783), berühmter Kastrat, von Cafaro entdeckt
und ausgebildet; ihm zu Ehren nannte er sich Caffarelli. „Später
sandte ihn Cafaro zu Porpora, der ihn nach fünf Jahren als Sänger
ersten Ranges entließ. [...] C. excellierte im pathetischen Gesange,
besaß aber auch eine immense Koloraturfertigkeit, besonders in
chromatischen Läufen, die er zuerst kultiviert haben soll.“ (Riemers
„Musik-Lexikon“. 7. Aufl. Leipzig 1909. S. 213.)
S. 265, Z. 23—25: Richard Roos! Kannst du's nicht [usw.]:
Ebenda Sp. 384: Den Schluß der Nummer bildet folgende Notiz:
„Literarisches. Wir machen unsere Leser auf eine Sammlung
von Gedichten aufmerksam, die immer seltener werden, nämlich
gutmüthig-launige, treuherzig-joviale: 'Ausgewählte neuere Gedichte
von Richard Roos. Leipzig, Hinrichs [1834]. 21 Gr.'
Die Freunde der Muse des biedern R. Roos werden darin den alten
lieben Bekannten wiederfinden, und wer ihn bisher nicht gekannt
haben sollte, wird es uns Dank wissen, daß wir ihn auf diesen
Dichter hinwiesen.“
Richard Roos ist der Deckname des schönwissenschaftlichen und
pädagogischen Schriftstellers Karl August Engelhardt (1768—1834).
S. 265, Z. 26 f.: Das Wagenf.[est] zu Dschagarn.[at] kennt man
[usw.]: Dschagernat (hind. Dschagannāth(a) = „Herr der Welt“,
eine besondere Bezeichnung für Wischnu; engl. Juggurnaut oder
Jagannath): ein berühmter Wallfahrtsort bei Puri in der ostindischen
Landschaft Orissa, in dem am Tage des Dschaggannātha eines
der größten religiösen Feste der Hindus, das Wagenfest (Rathay%
-atra) begangen wird. An diesem werden die Kolossalstatuen Wischnus,
seines Bruders und seiner Schwester auf riesigen, sechzehnrädrigen
Wagen von Tausenden von Pilgern durch die Stadt nach dem
Landhause des Gottes und wieder zurück nach dem Tempel gefahren.
Dabei geschah es früher gelegentlich, daß Fanatiker sich vor eines
[Bd. b6, S. 634]
der Räder warfen, um sich überfahren zu lassen. Eine eingehende
Schilderung des Festes findet sich in Monier Williams' Werke „Modern
India and the Indians. Being a series of impressions, notes,
and essays“. (3d ed. London, Trübner & Co. 1879.) S. 67—69; eine
Beschreibung des Tempels und des Wagenfestes mit Abbildungen,
z. B. der drei Statuen und des Wagens Dschagannāthas, in Emil
Schlaginweits „Indien in Wort und Bild. Eine Schilderung des indischen
Kaiserreiches.“ Bd. 1 (Leipzig, Schmidt & Günther 1880), S.
183—90. — Grabbe konnte Kenntnis von diesem Feste erhalten
haben durch die Beschreibung, die sich, wenngleich mit allgemeinerer
Lokalisation, in dem von ihm gelesenen Zimmermannschen „Taschenbuche
der Reisen“, und zwar in der ersten Abteilung des zwölften
Jahrgangs für 1813, S. 255—58 findet. (Im Jahrgang 10 desselben
Taschenbuches wird, S. 276—79, ein birmanisches Wagenfest geschildert.)
S. 265, Z. 29—33: Dummeres Zeug wie el. Welt nr. 107 [usw.]:
Ende Mai 1835 ging die Redaktion der „Zeitung für die elegante
Welt“ von August v. Binzer auf Gustav Kühne über, der sie mit
einer Erklärung „An die geneigten Leser“ in Nr. 107 vom 1. Juni
(S. 425) übernahm. Diese Erklärung beginnt mit den folgenden
Sätzen:
„Nur in Folge ganz bestimmter und scheinbar dringender Aufforderung
habe ich mich entschließen können, noch im Laufe des
Quartals die Leitung dieser Blätter zu übernehmen. Meinen Freunden
und meinen Feinden soll es leicht genug werden, auch auf
verändertem Terrain mich wiederzufinden. Hier zu sagen, was meines
Wissens an der Zeit sey, hieße die Wichtigkeit und die Flüchtigkeit
unserer Zeit selbst verkennen. Mich in kurzem verständigen zu
wollen, hieße mir selbst vorgreifen; eine Zeitung zu bevorworten.
hieße ihr eine üble Nachrede machen. Darf doch eine Zeitung selbst
nichts weiter seyn als ein Vor- und ein Nachwort für ihre Zeit,
eine Vorrede für das Kommende, das sich neu gestaltet, und eine
Nachrede für das Scheidende.“
S. 265, Z. 34: Daß der letzte Kaiser todt ist!: Kaiser Franz II.
war am 2. März 1835 gestorben. Sein Tod hatte eine große Zahl
von Nachrufen in prosaischer wie in poetischer Form im Gefolge.
Auch in Korrespondenznachrichten wurde das Ereignis oft behandelt,
und häufig fanden sich Anpreisungen von Gelegenheitsschriften in
den Intelligenzblättern.
S. 265, Z. 35 f.: p. 432. Theodor Maul über Talleyrand [usw.]:
Ebenda steht in Nr 108 vom 2. Juni auf S. 432 die folgende Notiz:
„Der neunte Band der bekannten Mémoires tirés des papiers d'un
homme d'état sur les causes secrètes [qui ont déterminé la politique
des cabinets dans les guerres de la révolution] etc. [von Armand-François
Comte d'Allonville (Paris, Michaud 1835)] enthält p. 182
sq. eine Charakteristik Talleyrand's, welche in mancher Beziehung
[Alexandre] Sallé's Mittheilungen über den Fürsten [in seinem Werke:
„Vie politique de Charles-Maurice, prince de Talleyrand“ (Paris,
Hivert 1834)] ergänzt, ohne daß doch über diese bedeutsame Persönlichkeit
schon ein Ganzes sich gewinnen ließe. Wir erwarten von
unserm Freunde Theodor Mundt eine Charakterskizze über
[Bd. b6, S. 635]
Talleyrand. Am Ende bleibt es doch immer dem deutschen Bewußtseyn
überlassen, eine weltgeschichtliche Figur zu würdigen.“
S. 265, Z. 37 f.: nr. 109. Ei, ei, Hr. Koenig, merken wir [usw.]:
Ebenda. Nr 109—14. 4.—13. Juni: „Der Hexenspruch.5* ([Dazu die
Anmerkung:]5*) Der treffliche Verf. der 'hohen Braut' übersandte mir
nur so eben diese Exposition zu einem Romane, mit dem er gegenwärtig
beschäftigt ist. Ich gebe dies Stück als eine Probe, wie der
Autor diesmal einen mittelalterlichen Stoff darzustellen gedenkt,
und hoffe ehestens über das Ganze berichten zu können. K.[ühne])
Von H.[einrich] Koenig.“ — Es ist das erste und zweite Kapitel des
ersten Buches der „Waldenser“, eines Romans, der 1836 bei Brockhaus
in Leipzig erschienen ist.
Grabbe meint fraglos die Besprechung von Königs Roman „Die
hohe Braut“ (2 Teile. Leipzig, Brockhaus 1833), die in Nr 133 der
„Zeitung für die elegante Welt“ vom 11. Juli 1833, S. 529—31 erschinen
und, in der Tat, von einer geradezu trunkenen Begeisterung
für dieses Werk erfüllt ist. „Endlich ein Roman, — so beginnt sie —
den ich aus vollem Herzen, mit vollen Backen, mit voller Feder loben
kann. Habe eine endlose, dürre Wüste durchirren müssen, habe
wenige Oasen mit einem kühlenden Trank gefunden, [...] und kann
mich in dieser ganzen trocknen Sommerreise jetzt erst zum ersten
Male ausstrecken in einem gesegneten, blühenden Lande. O, ich kann
den Lesern nicht beschreiben, wie wohl mir das gethan, mit welcher
Wollust ich die weiche, frische Luft dieses Buches eingesogen.
Nicht nur reizend, nicht nur bezaubernd ist das große dunkle Auge
dieser 'hohen Braut'; es ist beglückend, weil es die schönsten Kräfte
der Seele nicht allein weckt und beschäftigt, sondern wie eine unerschöpfliche
Gottheit befriedigt. Möge man mir's verzeihen, wenn
die kritische Zunge, von Freude und Genuß bestochen, lyrisch
schwatzt, und die letzten Gründe des Urtheils in der bunten Tracht
junger Freuden einhertanzen. Möge man eben diese Ohnmacht der
Kritik für die Kritik des Buches nehmen.“ Es sei, so wird weiterhin
ausgeführt, ein historischer Roman, so schön, wie Deutschland noch
keinen besitze, indem Geschichte, Terrain, Charakter und Begebenheit
sich darin auf seine so innige Weise durchdringe, daß keines von dem
andern zu trennen sei und jene „große, beglückende Harmonie des
Ganzen“ zustande komme, „wo alle Instrumente mit ihren individuellen
Tönen zusammenklingen und einen reinen Accord geben.“
(S. 531.) Ferner: Diese „hohe Braut ist jene junge Frau, hoch und
schön, die wir neue Geschichte nennen, ihr Odem ist der eines neuen
Jahrhunderts. Durch diese Totalität überwältigt sie das Herz mit
Entzücken. Wir kennen alle die einzelnen Theile des Gewandes, wir
haben in schönen Stunden den weichen Arm gefühlt, mit Thränen
die vollen Schenkel umarmt, in bebender Freude den schwellenden
Mund geküßt, unter feindlicher Umgebung an ihrem Herzen sicher
geruht, aber wir hatten das Auge, den Herold des Lebens, nicht gesehen,
den warmen Athem nicht gefühlt. Wir kannten sie, aber vermochten
es nicht, sie zu schildern. Das hat aber Herr König vermocht.
“ (S. 531.) Nicht genug tun kann sich der Rezensent, immer
neue Schönheiten hervorzuheben: „Und wie lieb sind die Frauen
dieses Romans!“ (S. 530); es sei ja „Alles so schön, so schön!“ (S. 529.)
[Bd. b6, S. 636]
Dagegen: „nichts von Tadel“! Ach, „wie selten darf man rücksichtslos
loben und lieben, und es ist doch so schön, wenn das Herz einmal
sprechen kann mit ungefesselter Zunge, wenn man sich ohne Bedenken
ins Meer der Schönheit stürzen und wie ein sommerheißer
Vogel baden darf.“ „Muß denn — so schließt er — der Kritiker auch
ein Zolleinnehmer seyn, darf er nicht lieben? Und wird nicht manche
Contrebande vorübergefahren, während er schwelgt in Liebesfreude
— ist nicht Liebe mehr als Aufrichtigkeit, oder vielmehr ist nicht
Liebe die höchste Aufrichtigkeit? Ich habe der hohen Braut zu tief
in die Augen gesehen, ich weiß nichts mehr von einzelnen Kleinigkeiten,
welche nicht nach meinem Geschmacke waren. —“ (S. 531.)
Verfasser der Besprechung ist Heinrich Laube. eppes höchter: Siehe
S. 266, Z. 3 f.: p. 458. Ochs. Napoleon hatt 'ne kurze Stirn [usw.]:
Ebenda Nr 115. 15. Juni. S. 458—59: Rezension der „Kaiserlieder,
von Franz Freiherrn Gaudy. Mit der Todtenmaske Napoleon's. (Leipzig,
Brockhaus. 1835. 198 S. gr. 12.) [Am Schlusse der Bücherschau
unterz.:] K.[ühne]“. S. 458 führt der Referent als Probe aus dem
Gedicht „Brienne“, dem zweiten der Sammlung, u. a. die folgende
Stelle an:
„Seht den Jüngling dort im Kreise sorglos schwärmender
Jenen Römerkopf, die hohe Stirn von dunklem Haar
Ernst und schweigsam. [...]“
(Kaiserlieder“ S. 6.)
S. 266, Z. 5 f.: Ueber die Eisenbahnen [usw.]: Im „Intelligenzblatt
der Zeitung für die elegante Welt“ Nr 6 vom 13. Juni wird
(S. 2—3) das folgende Buch angezeigt: „Belehrungen über die Anlegung
und Construction der verschiedenen Arten von Eisenbahnen.
Nach den neuesten Grundsätzen dargestellt. Eine Schrift für Alle,
die ein Interesse daran finden und sich über diesen Gegenstand
näher belehren wollen. Herausgegeben von Dr. Aug. Kühne.“
S. 266, Z. 7: Freimüthiger: Hutten war venerisch: Siehe die Anmerkung
zu
S. 266, Z. 7 f.: Ph. v. Leitner mag seine Shyloksexposition [usw.]:
„Der Freimüthige“ Nr 95—97. 14. — 16. Mai. „Ueber die Personen
im Kaufmann von Venedig. Ein Nachtgespräch nach der letzten
Aufführung. [Unterz.:] Ph. v. Leitner.“
S. 266, Z. 8—10: Morier ist ein trockner Kerl [usw.]: Ebenda
Nr 98—99. 18. u. 19. Mai: „Türkischer Gesellschaftston am Fuße des
Ararat. Nach Morier's Aejischa.“ Es handelt sich um eine Probe,
die folgender Übersetzung entnommen ist: „Aejischa, die Jungfrau von
Kars. Aus dem Englischen [James] Marier's, des Verfassers des Hadschi
Baba, Zohrab etc. etc. In drei Theilen. Braunschweig, Fr.[iedrich]
Vieweg und Sohn. 1835.“ (Sie findet sich dort im ersten Teile, Kap.
7, S. 132—40.) Der Verfasser — so heißt es in der ihr vorausgeschickten
Einleitung — Naturforscher und Belletrist zu gleicher Zeit,
habe in den Jahren 1809 und 1816 Reisen nach Vorderasien unternommen
und darüber, außer zwei wissenschaftlichen Beschreibungen,
auch mehrere Romane veröffentlicht, „in welchen wir mitten in das
[Bd. b6, S. 637]
orientalische Leben eingeführt werden, und in der lebendigsten Darstellung
persische, kurdische, armenische und türkische Sittenbilder an
uns vorübergehen sehen“. Das in Frage stehende Werk im besonderen
wird dann mit folgendem Satze charakterisiert: „Das Bestreben, orientalische
Sitten zu schildern, ist zu sichtlich, als daß wir es nicht als
den wichtigsten und interessantesten Theil des Buches empfehlen müssen,
um so mehr, als die große Gewandtheit des Autors dergleichen
Schilderungen so natürlich herbeizuführen versteht, daß wir die Absichtlichkeit
nur selten wahrnehmen, und sich Alles ungezwungen an
einander reihet.“ (S. 394.)
S. 266, Z. 10—12: Griepenkerls Uebers. des Sopphokl. [usw.]:
Ebenda Nr 98. S. 396: In der Rubrik „Zur Tagesgeschichte“ steht
folgende Notitz:
„Neue Uebersetzung des Sophokles. — Von dem
durch seine 'Dichtungen aus der griechischen Vorzeit' [gemeint ist die
Gedichtsammlung „Bilder der griechischen Vorzeit.“ Berlin, Mittler
1833] vortheilhaft bekannten Herrn Robert Griepenkerl, der,
aus Braunschweig gebürtig, hier [in Berlin] sein Domicil erwählt hat,
erscheint eine neue metrische Uebersetzung der Tragödien des Sophokles,
ein Unternehmen, was gewiß wieder an der Zeit ist, da jede
Zeit ihr eigenes Sprach-Gewand für die ewigen Heroen der Vorwelt
verlangt, und das Solgersche, trotz seiner großen Verdienste, für
unser Bedürfniß nicht mehr ausreicht. Bis jetzt ist ein erstes Heft,
König Oedipus enthaltend, hier [bei Mittler] 1 erschienen. Wir versparen
uns, näher darüber zu sprechen, bis mehrere bekannt gemacht
sein werden und einen Vergleich mit den früheren Uebersetzungen
gestatten. Jedenfalls kann man schon jetzt sagen, daß auch der Laie
mit Leichtigkeit den Kothurnschritt des großen Tragikers verfolgen
wird. — [...]“ — Griepenkerls Übersetzung des „König Oedipus“
war größtenteils schon auf dem Gymnasium entstanden. Sie kann
zwar, wie Otto Sievers („Robert Griepenkerl, der Dichter des
'Roberspierre'. Biographisch-kritische Skizzen.“ Wolfenbüttel, Zwißler
1879. S. 13) urteilt, „den strengern Anforderungen philologischer
Gelehrsamkeit“ nicht genügen, „empfiehlt sich aber durch ihre wohlklingenden,
das griechische Colorit ziemlich glücklich treffenden
Verse.“ Trotzdem ist sie beim Publikum spurlos vorübergegangen,
und dies mag einer der Gründe sein, die den Verfasser bestimmt
haben, ihr nur noch die Übersetzung der „Antigone“ folgen zu lassen,
die aber erst 1844 (bei Westermann in Braunschweig) herausgekommen
ist. — Der „König Oedipus“, im Versmaß des Originals übersetzt
von Karl Wilhelm Ferdinand Solger, war im Jahre 1805 bei
Adamsohn in Berlin erschienen.
S. 266, Z. 12 f.: Aus „dem Reisejournal eines Zukünftigen“ [usw.].
Ebenda Nr 106. 29. Mai. S. 427—28: „Aus dem Reisejournal eines
Todten. Die römische Uhr.“ Der Aufsatz schildert die Nachteile
des eigentümlichen Prinzips, nach dem in Rom (und einigen benachbarten
Städten des Kirchenstaats) die Tageszeit bestimmt wird:
man zählt darnach die Stunden bis 24, und der Moment des Untergangs
der Sonne an jedem Tage des Jahres ist ein für allemal auf
23½ Uhr festgesetzt.
[Bd. b6, S. 638]
S. 266, Z. 13—15: Mad. Birch-Pfeiffer bezahlt [usw.]: Ebenda
findet sich S. 428 folgende Notiz 'Zur Tagesgeschichte':
„Das Schauspiel: 'Johannes Guttenberg,' von Madame [Charlotte]
Birch-Pfeif[f]er, welches in Berlin wenig Glück machte, hat in Breslau,
Hamburg und Posen sehr viel Beifall gefunden, welches um
so auffallender ist, als man Freunde des Drucks weniger an letztgenannten
Orten hätte suchen sollen.“
S. 266, Z. 15—17: Nach allem, was ich lese, ist Seydelmann
[usw.]: Karl Seydelmann gab vom 2. April bis zum 26. Mai am
Berliner Hoftheater ein Gastspiel, das erst nach seiner Beendigung
von Wilibald Alexis eingehend besprochen (siehe die Anmerkung
zu
und wieder erwähnt wurde. Von diesen Erwähnungen können die
folgenden Grabbe zu seiner Äußerung bestimmt haben: Seydelmann
„hat sich [als Carlos im 'Clavigo'] als der denkende, treffliche
Charakteristiker bewährt, als den ihn der Ruf bezeichnet.“
(W.[ilibald] A.[lexis] in Nr 71 vom 9. April, S. 288.) — „So
meisterhaft er auch im vierten Debüt den Charakter Friedrich's II.
in Raupach's Friedrich und sein Sohn nach seiner Auffassung durchführte,
so ging die Aufgabe doch über die eigentliche Lebensregion
seiner künstlerischen Thätigkeit, und er erreichte nur auf Umwegen
sein Ziel, wo er sonst Prototypen hinstellt.“ (... t in Nr 73 vom
11. April, S. 296.)
S. 266, Z. 19 f.: Gestohlen aus Eichhorn d. J.: Grabbe meint offenbar
Karl Friedrich Eichhorn (1781—1854), den „Vater der deutschen
Rechtsgeschichte“, Sohn des berühmten Orientalisten Johann Gottfried
Eichhorn.
S. 266, Z. 20—22: Rhapsod. Bemerk. über Staatsdienst [usw.]:
„Minerva“ Bd 174, S. 425—55 (Juni): „Rhapsodische Bemerkungen,
den Staatsdienst betreffend. [Unterz.:] —i—.“ Der Verfasser polemisiert
gegen einen, wie es ihm scheint, von hoher Stelle inspirierten
Artikel in der „Darmstädtischen Zeitung“ (Nr 322 vom 20. November
1834), in welchem der Grundsatz aufgestellt worden ist, daß
jeder öffentliche Beamte „in seiner dienstlichen Stellung sowohl, als
in seinen außerdienstlichen Beziehungen, strenge dem System der
höchsten Staatsregierung gemäß zu wirken“ habe. (S. 427.) Diesen
Grundsatz erklärt er für staatsgefährlich und verderblich, und versucht
den Nachweis für diese Behauptung zu erbringen.
S. 266, Z. 24—26: Im Ausland nr. 154 seyn wir auch von den
Franzosen erwähnt [usw.]: „Ausland“ Nr 154. 3. Juni. S. 613—14:
„Neue französische Literatur. [Rezension des] Théâtre Européen:
nouvelle Collection des chefs-d'ouvres du théâtre Allemand, Anglais,
Espagnol, Danois, Français, Hollandais, Italien, Polonais, Russe,
Suédois etc. avec des notices et des notes historiques, biographiques
et critiques.“ Der Rezensent übt sehr scharfe Kritik an diesem, u. a.
auf St. Marc-Girardin, [Xavier] Marmier und [Jules-Gabriel] Janin
zurückgeführten Unternehmen, ganz besonders an dem Plane für
das deutsche Theater, dessen erste Serie Lessing, Schiller und deren
Zeitgenossen, dessen zweite Goethe, Kotzebue, Werner, Müllner,
aus der gegenwärtigen Epoche aber Grabbe, Raupach, Grillparzer,
Iffland, Kleist u. s. w. enthalten solle. (S. 613.)
[Bd. b6, S. 639]
S. 266, Z. 27—29: Ich hoffe heute mit Zandyck fertig zu werden:
Seit Juni arbeitete Grabbe an der Rezension der im Schreinerschen
Verlage erschienenen „Erinnerungen aus der Schweiz“ von Moritz
Zandyck.
S. 266, Z. 33 — S. 267, Z. 2: Das Vorbild zu dieser Szene ist
die 27. Historie des Volksbuches (von 1515), welche „sagt wie Ulenspiegel
dem landgroffen von Hessen malet, vnd in weiß macht, wer
vnelich wer der künt es nit sehen.“ Vgl. Volksbücher des 16. Jahrhunderts.
Herausgegeben u. erklärt von Felix Bobertag. (= Kürschners
Deutsche National-Literatur. Bd 25.) Berlin u. Stuttgart, Spemann
o. J. [1886—90.] S. 51—53.
1) Diese eckigen Klammern finden sich im Originaltexte.