Kettembeilius, anbei die Druckfehler. Hältst Du einige für unnütz, nimm sie weg. Setze auch die zum Barbarossa hinter Heinr. VI. Schaffe doch die Scenen aus Aschenbröd. in den Gesellschafter. 5Napoleon ist nunmehr in der letzten Scene. Bei ihm lasse mir aber den vollsten Lauf. All mein Geist, jede meiner Ansichten, muß soviel als möglich hinein. Darum, so weh' es mir thut, schreibe ich ihn in — Prosa, aber wie ich hoffe, in lutherisch kräftig biblischer, wie z. B. die Räuber. Ich kann 10die Artillerie-Trains, die congrevischen Raketen pp. nicht in Verse zwingen, ohne sie lächerlich zu machen. Schiller dachte bei Wallenstein erst eben so, änderte nachher — aber das ist ein Unterschied: Wallenstein liegt uns fern genug, um ihn in das Phantastische zu ziehen, Napoleon bewegt sich zu nah 15in unserer prosaischen, und darum so sehr musikalischen Zeit (denn die Extreme berühren sich). Die Packete mit Büchercatalogen erhielt ich und besorge sie; aber einen Professor Overbeck in Lemgo gibt's schwerlich. Der Bote soll sich dort erkundigen. — Es wird jetzt zu viel 20geschrieben als daß Einzelnes, und sey es von Gott, schnell durchdringen könnte. Man merkt's überall. Die Zeiten von Goethes, Wielands Auferstehen, wo man Jahre lang sich um Bürgers Ballade stritt, sind dahin (fuz à qui sagt man hier). Selbst Selbstausposaunen (womit der alte Narr Goethe vorausgeht) 25hilft wenig. Thu' Du es etwas aber mit unsren Sachen immerhin. Indeß glaube ich doch, das Schlechte wird allmählig verfliegen, und das Gute bleiben, jedoch nicht im Laden, sondern im Verkaufe. — Apropos, bei den Druckfehlern zu Barb. u. H. VI. mußt Du die Zeilen nachzählen. Nach 30meiner Manier bin ich consequent gewesen und habe stets von oben gezählt, oft ist's aber von unten näher. Mach's wie Du willst, besorge nur den Heinrich schnell. Daß ich erst jetzt antworte, hat seine guten und schlimmen Gründe. A) Gute: ich mußte den Heinrich erst 3 Mal durchlesen, 35um wegen der Druckf. sicher zu seyn. B) Schlimme: obgleich ich viel arbeite, leide ich an Händen und Füßen schnöde an der Gicht. Und dazu gebe ich alle meine alten Bohnen (Geschäfte) selbst im Bette ab. Ich kann das übrigens so ziemlich, weil ich hier nicht ganz unbegünstigt bin. — Bitte, 40treib den Menzel. Grüß ihn von mir, und sprich von [GAA, Bd. V, S. 306]
meiner Krankheit, wegen deren ich nicht schreiben könnte. — Einige Druckfehler bei Heinr. VI. verschuldet sicher der Setzer. Aber ich habe auch curiöse Abschreiber. Unbedeutend sind die Fehler fast alle. — Hinter dem Druckfehlerverzeichniß 5ist eine Notiz für Dich. — Napoleon hilft uns vielleicht schon durch den Namen. — Die Venturinische Chronik pp. muß ich bis zu Napoleons Beendigung behalten. — Napoleon ist übrigens eine so große Aufgabe nicht. Er ist ein Kerl, den sein Egoismus dahin trieb, seine Zeit zu benutzen, 10— außer eigennützigen Zwecken, hat er schon als Corse, als Halbfranzose nie gewußt, wohin er eigentlich strebte, — er ist kleiner als die Revolution, und im Grunde ist er nur das Fähnlein an deren Maste, — nicht Er, die Revolution lebt noch in Europa, — man siehts an den Wahlen in Frankreich. Er 15hätte die eben so gehaßt wie Polignac. Nicht Er, seine Geschichte ist groß. Sein Geist ist gut (?) und tüchtig, er hat oft gesiegt, seine Trommeln tönen vielen Eseln noch so laut, wie Paganinis elende G-Saite (nämlich des genialen Charlatans), — aber wodurch siegte er? Er hatte nie 20einen großen Gegner, — seine Gegner waren durch Anciennität, er durch Geist befördert. Weil Anciennität im Alterthum so wenig galt, darum ist es so jung, — darum finden wir trotz der schlechten damaligen Zeit dort in 10 Jahren 100 Mal mehr große Leute als jetzt in 20, — darum hat die 25Revolution, wo aus dem Kothe auch etwas hervortauchen konnte, Aehnlichkeit mit ihm. Im Drama werde ich aber aus Klugheit den l'empereur et roi hoch halten. Ich kann's auch mit gutem Gewissen. Er ist groß weil die Natur ihn 30groß machte und groß stellte, gleich der Riesenschlange, wenn sie die Tiger packt. — Ich kann nicht weiter, meine Hände.
35 (Diesen Brief konnte ich nicht wieder durchlesen. Antworte bald.) Heinrich der VI. hat Fehler, ist aber eben so wie D. J. u. F. besser als der widerlich — Barb. Meine Ansicht und auch Anderer. 40 (Nota. Frei machen konnt' ich diesen Brief nicht. Verzeihe.) [GAA, Bd. V, S. 307]
|
  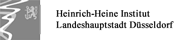 | © 2009—2011 by Lippische Landesbibliothek - Theologische Bibliothek Detmold, Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier und Heinrich-Heine-Institut Düsseldorf Home | Impressum | Kontakt |

272.
H: Früher im Besitze Oscar Blumenthals; zur Zeit der Entstehung
von WGr nicht mehr aufzufinden; heute verschollen.
D: WBl IV 449—52, als Nr 24.
S. 305, Z. 20: sey] sei D
S. 305, Z. 35: seyn] sein D
S. 306, Z. 15: Polignac] Polizeno D
S. 306, Z. 36: bald.)] bald. D
S. 305, Z. 4: Schaffe doch die Scenen aus Aschenbröd. in den
Gesellschafter: Siehe die Anm. zu
S. 305, Z. 8 f.: Prosa, aber wie ich hoffe, in lutherisch kräftig
biblischer: Vgl. dazu
S. 305, Z. 15: in unserer prosaischen, und darum so sehr musikalischen
Zeit: Vgl. dazu
S. 305, Z. 18: einen Professor Overbeck in Lemgo gibt's
schwerlich: Ein solcher ist in der Tat durch das Lemgoer Kontributions
-Register für 1830 nicht nachzuweisen. Möglicherweise ist
der am 20. März 1838 in einem Alter von 49 Jahren und vier
Monaten zu Lemgo als Prorektor am dortigen Gymnasium an der
Schwindsucht verstorbene Friedrich Justus Ludwig O. gemeint. Jedoch
hat es zu der fraglichen Zeit auch noch andere Träger des Namens
in Lemgo gegeben.
S. 305, Z. 33: fuz à qui sagt man hier: Eine befriedigende Deutung
dieser Worte, die heute selbst älteren Kennern des Lippischen
fremd ist, kann nicht gegeben werden. Möglicherweise handelt es
sich um eine französische Wendung, die während der Zeit der
Besetzung Lippes durch französische Truppen hängen geblieben, eine
Weile in verderbter Form von der einheimischen Bevölkerung gebraucht
und dann wieder verschwunden ist; also um eine Art
Besatzungsfranzösisch. Dann muß man freilich auf die Frage, welche
Wendung dies sei, die Antwort schuldig bleiben. Der Sinn der
Worte ist klar: sie wollen nichts anderes besagen als die beiden
vorhergehenden Wörter 'sind dahin'. Deswegen könnte man versucht
sein, 'fuz à qui' mit 'futsch' in Verbindung zu bringen, jenem
zuerst 1792 aus ober- und mittelrheinischen Mundarten verzeichneten
Worte, zu dem sich nachträglich fremd klingende Weiterbildungen
eingestellt haben; vgl. „Trübners Deutsches Wörterbuch“ Bd 2, S.
491. Der Beweis jedoch, daß man es auch im vorliegenden Falle
mit einer solchen zu tun habe, ist nicht zu erbringen.
S. 306, Z. 15: Polignac: Grabbe meint fraglos den Fürsten Jules
Auguste Armand Marie von P. (1780—1847), Minister des Auswärtigen
und Präsidenten des letzten Kabinets Karls X. Dieser hatte
am 16. Mai die Kammer der Deputierten aufgelöst und neue Wahlen
angeordnet. Sie fielen größtenteils im Sinne der Opposition aus: die
Regierung erhielt nur 145 Stimmen, ihre Gegner 272. Darauf betrieb
und unterzeichnete P., als ein entschiedener Ultra, die Ordonnanzen
[Bd. b5, S. 619]
vom 25. Juli, welche die Julirevolution und den Sturz der Dynastie
nach sich zogen.
S. 306, Z. 18: wie Paganinis elende G-Saite: Vgl. dazu
S. 96, Z. 8—22.